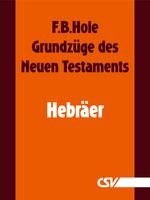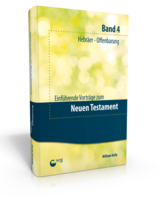Einführende Vorträge zum Hebräerbrief
Kapitel 13

Das letzte Kapitel folgt mit einigen praktischen Ermahnungen in Hinsicht auf ein Anhalten in der Bruderliebe, Freundlichkeit gegen Fremde bzw. Gastfreundschaft und zuletzt Mitleid mit den Gefangenen. „Gedenket der Gefangenen, als Mitgefangene [und] derer, die Ungemach leiden.“ (V. 3). Erneut betont der Schreiber nachdrücklich die Ehre und die Reinheit des Bandes der Ehe und den Abscheu Gottes gegen jene, die es verachten und verderben, sowie das unumstößliche Gericht, welches über solche kommt. Er dringt auf einen Wandel ohne Habgier und einen Geist der Zufriedenheit, dessen Grundlage auf dem Vertrauen beruht, daß unser Herr für uns besorgt ist.
Gleichzeitig ermahnt er die Gläubigen in Bezug auf ihre Führer, das heißt jene, die sie geistlich leiteten. Es ist wahrscheinlich, daß die hebräischen Gläubigen etwas aufsässig waren. Diese Beziehung zu ihren Führern stellt er in unterschiedlicher Weise dar. Zunächst sollten sie jener gedenken, die sie einst lenkten. Letztere waren nun vom Schauplatz ihrer Übungen und ihrer Arbeit abgetreten. „Den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach.“ (V. 7).
Das veranlaßt den Apostel natürlicherweise dazu, den Einen vor sie zu stellen, Der niemals endet: „Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“ (V. 8). Warum sollten Seine Heiligen sich durch Fragen über Essen und Trinken fortreißen lassen? Er ist unwandelbar derselbe, und zwar für immer, so wie Er es immer war. „Laßt euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren; denn es ist gut, daß das Herz durch Gnade befestigt werde.“ (V. 9). Beachte, wie dieses Wort, dieser Gedanke, überall in diesem Brief im Vordergrund steht! Warum sollten sie zurückgehen zu „Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten“?
Wurden sie verspottet, weil sie keinen Altar hatten - weil sie mit nichts Heiligem und Herrlichem in Verbindung standen? Das war einzig und allein auf Israels Blindheit zurückzuführen. Denn der Apostel sagt: „Wir haben einen Altar“ - ja, mehr als das - „wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen.“ (V. 10). „Du, der du zur Stiftshütte (er nennt das Heiligtum weiter so, obwohl es damals der Tempel war) gehst, hast kein Recht auf unseren Altar mit seinen unerschöpflichen Vorräten. Für uns ist Christus alles.“
Diese Aussage gibt Gelegenheit zu einer bemerkenswerten Anspielung, bei der ich einen Augenblick verweilen muß. Der Apostel richtet die Aufmerksamkeit auf die wohlbekannten Zeremonien des Versöhnungstags. Auch wenn es nicht ausschließlich um diesen Tag geht - auf jeden Fall geht es um Tiere, deren Leiber außerhalb des Lagers verbrannt und deren Blut innerhalb des Vorhangs gebracht wurden. Entdeckst du nicht in dieser strengen Verknüpfung die besonderen Kennzeichen des Christentums? Ach!, es ist nicht nur der Stumpfsinn jüdischer Vorurteile - genau diese Wahrheit wird von jedem System, dessen sich die Menschen in der Christenheit rühmen, geleugnet. Gerade wegen diesen Kennzeichen wurde das Evangelium vom Judentum verachtet. Doch die Nichtjuden haben keinen Grund, stolz zu sein. Sie sind nicht weniger ungläubig und nicht weniger eingebildet dem wahren Christentum gegenüber. Die Christenheit nimmt genau die Mittelposition eines Judentums zwischen diesen beiden Gegensätzen ein. Die „Mitte“ scheint immer gut zu sein und hört sich auch gut an; und doch ist sie für einen Christen falsch. Die beiden Extreme sind für alle Liebhaber des via media 1 des religiösen Rationalismus anstößig. Beide Wahrheiten müssen im Christentum und in einem Christen in einem gewissen Sinn vereinigt sein, wenn er sie unbeschädigt und rein bewahren will. Die erste besagt, daß der Christ im Geist durch die Erlösung jetzt ohne Flecken oder Schuld in die Gegenwart Gottes gebracht worden ist. Wenn du überhaupt an Christus glaubst, ist das dein Teil - nichts weniger! Falls ich erkannt habe, was die Erlösung Christi für alle, die glauben, vollbracht hat, muß ich auch erkennen, daß mir Gott dieses Vorrecht gegeben hat. Er ehrt das Werk Christi entsprechend Seiner Wertschätzung der Wirksamkeit desselben. Genauso ist es auch nach Seinen Ratschlüssen uns betreffend zu Christi Herrlichkeit ausgeführt worden. Davon sahen wir etwas in Kapitel 10. Und was hat es bewirkt? Als Christ bin ich jetzt nach Gottes Willen frei, um in Frieden und dem festen Bewußtsein Seiner Liebe in das Allerheiligste einzutreten - ja, das gilt jetzt schon! Natürlich spreche ich nur von einem Eingehen dort im Geist.
Die zweite Wahrheit betrifft den äußeren Menschen. Wir müssen lernen, wozu wir berufen sind. Der Apostel folgert: So wie das Blut der Tiere in das Heiligtum gebracht wurde, während die Leiber derselben hinaus getragen und verbrannt wurden, gilt derselbe Grundsatz auch für uns. Wenn ich schon gegenwärtig ein unangreifbares Recht habe, in das Allerheiligste einzutreten, darf ich nicht vor dem Platz der Asche außerhalb des Lagers zurückschrecken. Wer das eine besitzt, darf das andere nicht scheuen. In diesen beiden Stellungen besteht zur Zeit unsere doppelte Beziehung durch den Glauben, während wir uns noch auf der Erde befinden. Der Apostel besteht ernstlich auf beidem. Wir gehören zum Allerheiligsten; und wir handeln richtig, wenn wir dort unsere Aufgabe erfüllen und Gott anbeten - ja, wenn wir Gott allezeit im Gebet nahen. Indem wir durch das Blut Jesu nahe gebracht worden sind, haben wir vollkommenen Zugang, sodaß nichts zwischen Gott und uns steht; denn Christus hat einmal gelitten, um uns zu Gott zu führen. Jetzt tritt Er für uns ein, damit wir an diesem Platz der Nähe Gemeinschaft mit Ihm haben. Dieses Bringen zu Gott setzt voraus und gründet sich auf die Tatsache, daß unsere Sünden vollkommen durch Sein eines Opfer weggenommen sind. Ansonsten wäre es der größte Wahnsinn, einem solchen Gedanken zu frönen. Wäre es nicht die Wahrheit, bestände in dieser Vorstellung tatsächlich die Höhe der Anmaßung. Doch weit davon entfernt! Hierin liegt die einfache Lehre des Evangeliums. „Christus (hat) einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten“, sagt ein anderer Apostel, „auf daß er uns [nicht zu Vergebung noch Friede noch in den Himmel, sondern] zu Gott führe.“ (1. Petrus 3, 18). Vergleiche auch mit Epheser 2! Wir sind also, von unseren Sünden gewaschen, zu Gott gebracht worden und nach unserem Brief sogar in das Allerheiligste, wo Gott Sich selbst enthüllt. Die wahre Anmaßung besteht demnach darin, vorzugeben, ein Christ zu sein, und trotzdem die grundlegende Anfangswahrheit des Christentums diesbezüglich anzuzweifeln.
Doch die Leiber jener Tiere wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Mein Platz, soweit es mein Leben im Leib betrifft, ist ein solcher der Schande und der Leiden in dieser Welt.
Treffen diese beiden Gesichtspunkte auch auf dich zu? Wenn du ausschließlich den einen von ihnen schätzst und verwirklichst, besitzt du nur die Hälfte des Christentums - ja, nur die Hälfte seiner Grundlagen. Gelten sie beide für dich? Dann darfst du Gott danken, weil Er dich so gesegnet und dir als für dich selbst gültig dieses Bewußtsein gegeben hat. Anderenfalls wäre deine vollkommene Freude und das Tragen des angemessenen Zeugnisses, daß du ein einfältiger und von der Welt abgesonderter Knecht Christi hienieden bist, wirksam verhindert. Es stimmt natürlich - der Herr beruft nicht immer sofort auf diesen Platz der Verachtung und des Leidens. Zunächst führt Er uns in den Genuß und die Nähe Seiner Gegenwart. Er schenkt uns Freude an der Vollkommenheit, mit der Christus uns von unseren Sünden in Seinem Blut gewaschen und zu Königen und Priestern Seinem Gott und Vater gemacht hat. Aber danach weist Er uns auf den Platz Christi außerhalb des Lagers hin. „Laßt uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“ (V. 13). Gerade davor schreckten diese jüdischen Christen zurück, falls sie sich dem nicht sogar widersetzten. Sie hatten sich noch nicht auf Leiden eingestellt. Verachtung war in ihren Augen abstoßend. Sie ist auch der menschlichen Natur nicht angenehm. Der Apostel läßt sie indessen wissen, daß, falls sie ihre wahre Segnung kannten, der Platz außerhalb untrennbar mit ihrer Nähe zu Gott verbunden ist. Das konnte schon im Sinnbild aus dieser zentralen und außerordentlich bedeutungsvollen Zeremonie des jüdischen Systems entnommen werden. Darin liegt die Bedeutung von dem Blut, das hinein getragen, und von den Leibern, die außerhalb verbrannt wurden.
Laßt uns jetzt versuchen, diese beiden Wahrheiten - vollkommene Nähe zu Gott und der Platz äußerster Verachtung in Gegenwart der Menschen - zu verbinden! Die Christenheit zieht den Mittelweg vor. Sie wünscht weder eine bewußte Nähe zu Gott noch den Platz der Schmach Christi unter den Menschen. Alle Bemühungen der Christenheit gehen dahin, das eine zu leugnen und dem anderen auszuweichen. Ich frage meine Geschwister hier, ob sie mit Eifer und Ernst für sich selbst und ihre Kinder von Gott erwarten, daß Er sie davor bewahre? Wir sollen nichts zulassen, was diesen Lehren, welche unsere höchsten Vorrechte und unsere wirklichste Herrlichkeit als Christen hienieden ausmachen, entgegensteht oder sie schwächen könnte. Was für eine Überraschung für die hebräischen Gläubigen, solche Wahrheiten so eindringlich im Sinnbild sogar im jüdischen System vorzufinden!
Doch der Apostel geht weiter, wie es tatsächlich der Wahrheit angemessen ist. Die angeführten beiden Kennzeichen weist Er sogar in Christus selbst nach. Offensichtlich ist Er in Seiner Person in das Allerheiligste gegangen. Aber wie? Was war diesem unmittelbar voraus gegangen? Das Kreuz! So müssen also Kreuz und himmlische Herrlichkeit zusammen gehören. Der gnädige Herr zeigt und verlangt, daß wir Seinen eigenen Platz im Himmel und auf der Erde einnehmen. „Laßt uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers.“ Genau das ist das abschließende Wort in Hinsicht auf unsere Praxis im Hebräerbrief. Gott stand im Begriff, das jüdische System öffentlich beiseite zu setzen, entsprechend der Tatsache, daß es sittlich schon im Kreuz Christi gerichtet war. Als der Messias gekreuzigt wurde, war dem Grundsatz nach das Judentum tot. Falls es in einem gewissen Sinn noch erhalten wurde, so nur eine schickliche Zeit vor seiner Bestattung. Aber jetzt sandte Gott Seinen abschließenden Aufruf, der sich auf ihre eigenen Zeremonien stützte, an Sein Volk, das nach dem Toten verlangte, anstatt den Lebendigen in der Höhe zu sehen. Er wiederholt sozusagen: „Laß die Toten ihre Toten begraben.“ [Lukas 9, 60]. Die Römer sollten ihres letzten, traurigen Amtes walten 2. Aber du, der du an Jesus glaubst - warte nicht auf die Römer! Laß dir das Judentum nichts als ein Leichnam sein, der dich nichts mehr angeht! „Laßt uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“
Das war ein letzter Ruf - und wie gnädig! Hätte Gott den Brief an die Hebräer zurückgehalten bis Er Seine Armeen ausgesandt, ihre Stadt verbrannt und ihr Staatswesen, Wurzel und Zweig, vernichtet hatte (vgl. Matthäus 22, 7!), hätte jemand entgegenhalten können, daß die Christen das jüdische Ritual solange schätzten, wie es zur Verfügung stand, und erst aufgaben, als es weder einen irdischen Tempel noch Opfer und Priester mehr gab. Doch Gott sorgte dafür, daß Seine Kinder herausgerufen wurden und das ganze System aufgaben, bevor es zerstört wurde. Sie sollten es den Toten überlassen, ihre Toten zu begraben; und so handelten sie. Aber das Christentum hat in keinster Weise aus diesem Aufruf Nutzen gezogen und ist dazu verdammt, durch ein Gericht umzukommen, das noch ernster und weitreichender ist als jenes, welches den alten Tempel hinwegfegte.
Darauf folgt noch ein anderer Gesichtspunkt in Verbindung mit dem, was wir schon betrachtet haben, und der unsere Aufmerksamkeit fordert. Anstatt sehnsuchtsvoll an die Dinge zu denken, die in Kurzem zerstört werden sollen, oder unzufrieden zu sein mit der Aufforderung, hinaus zu dem Platz der Schande Christi auf der Erde zu gehen, bewirkt das Christentum, welches das Judentum jetzt ersetzt, daß wir „stets ein Opfer des Lobes darbringen.“ (V. 15). Es gibt zwei Arten von Opfern, zu welchen wir heutzutage berufen sind. „Durch ihn nun laßt uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.“ Das eine mag von einem höheren Charakter sein als das andere, dennoch sollte das höhere niemals das niedrigere verdrängen oder es uns vergessen lassen.
Dann folgt eine zweite Ermahnung bezüglich der Führer oder leitenden Männer unter den Geschwistern. (Vergl. Apostelgeschichte 15, 22!). „Gehorchet euren Führern und seid unterwürfig; denn sie wachen über eure Seelen (als die da Rechenschaft geben sollen).“ (V. 17). Dieser Vers bestätigt natürlich keineswegs den gewöhnlichen und anstößigen Irrtum, daß Pastoren Rechenschaft über die Seelen ihrer Herde zu geben hätten. Diese Vorstellung hat der Aberglaube ausgebrütet, um eine unechte klerikale [Geistlichkeits-] Ordnung aufzurichten. Die eigentliche Bedeutung liegt darin, daß die geistlichen Führer Rechenschaft von ihrem eigenen Verhalten bei der Aufsicht über andere Seelen ablegen müssen; denn dieses Werk erfordert viel Wachsamkeit über das Ich, Geduld mit anderen, mühevolle Arbeit, demütige Gesinnung und jene herzliche Liebe, welche alles erträgt, alles erduldet und alles glaubt. Darum finden wir diese ernste Ermahnung bezüglich der abzulegenden Rechenschaft in der Zukunft. Sie wachen als solche, die Rechenschaft ablegen müssen. Die Zeit für diese selbstverleugnende Arbeit und Beständigkeit in der Gnade ist jetzt. Bald muß dem Herrn, der sie eingesetzt hat, Rechenschaft abgelegt werden. Dabei wünscht der Apostel, daß ihr Werk der Aufsicht mit Freuden getan werde und nicht mit Seufzen, weil letzteres für die Erlösten nicht nützlich wäre.
Aber selbst der Apostel fühlte, wie sehr er die Gebete der Gläubigen nötig hatte. Das geschah nicht, weil er in die Irre gegangen war, sondern weil er sich bewußt war, daß sein Werk in keinster Weise durch ein schlechtes Gewissen gehemmt wurde. „Betet für uns; denn wir halten dafür, daß wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. Ich bitte euch aber umsomehr, dies zu tun, auf daß ich euch desto schneller wiedergegeben werde.“ (V. 18-19).
Dann befiehlt er die Erlösten Gott an. „Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werke, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ (V. 20-21).
Zuletzt bittet er die Geschwister, das Wort der Ermahnung zu ertragen. Dabei geht es vornehmlich um den Inhalt dieses Briefes an jene, die nicht wie die Versammlungen aus den Nationen so oft Gelegenheit hatten, aus seinem Lehren Nutzen zu ziehen. Daher können wir auch leicht das Zartgefühl, mit dem er sie flehend bat, und den hinzugefügten Satz: „Ich habe euch auch mit kurzen Worten geschrieben“ (V. 22), verstehen. Auch scheint es keinesfalls selbstverständlich zu sein, daß jemand anders, außer dem großen Apostel, ihnen von seinem Kind und Mitarbeiter berichtet. „Wisset, daß unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßet alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen! Amen.“ (V. 23-25).
So schließt der Apostel diesen auffallenden und kostbaren Brief - randvoll bis zum Überfließen mit Wahrheiten, die eine besondere und sehr anrührende Bedeutung für einen Juden haben mußten. Nichtsdestoweniger wird er sicherlich genauso sehr von uns benötigt. Er ist für uns in diesen Tagen genauso reich an Belehrung wie für alle anderen Gläubigen, die bisher gelebt haben. Laßt mich als abschließendes Wort sagen - und ich sage es wegen besonderer Umstände, die ernst vor unseren Herzen stehen sollten, mit Bedacht -, daß keine Befreiung, die wir genießen können, kein Platz hinsichtlich des Todes dem Gesetz, der Welt oder der Sünde gegenüber und kein Vorrecht aus der Einheit mit Christus heraus einer Seele erlaubt, sich den Wahrheiten, die in diesem Brief an die Hebräer enthalten sind, zu entziehen. Noch wandeln wir auf der Erde. Wir befinden uns demnach an dem Ort, wo wir Schwachheit empfinden, wo Satan uns versucht und wo wir durch Unwachsamkeit versagen können. Der größere Teil der Gefühle eines Christen wird durch diesen ganzen Schauplatz der Sünde und des Leids, durch welchen wir zum Himmel voranschreiten, auf unseren Heiland gerichtet. Wenn wir unseren christlichen Charakter praktisch allein an solchen Briefen wie die an die Epheser und Kolosser ausrichten - verlaßt euch darauf, auch wenn wir dort nicht die harten Züge des Gesetzes finden, werden wir dennoch weit von jenen innigen Gefühlen entfernt sein, die einem Gläubigen zustehen, der die Gnade Christi empfindet! Seien wir versichert, daß es von größt-möglicher Bedeutung ist, die Wirksamkeit der gegenwärtigen Liebe und Sorge Christi für uns zu schätzen - die Wirksamkeit jenes Priestertums, welches Gegenstand dieses Briefes ist! Auch wenn wir die Dauerhaftigkeit der Auslöschung unserer Schuld festhalten, sollten wir nichtsdestoweniger anerkennen, daß wir notwendig eine solche Person wie Christus benötigen, der für uns eintritt und in Gnade sich mit all unseren Schwachheiten und Fehlern beschäftigt. Der Herr möge verhüten, daß irgend etwas unseren Sinn für den Wert und das Erfordernis einer solchen täglichen Gnade abschwächt! Es mag durchaus etwas vorkommen, was eine Beschämung des Angesichts (vgl. Esra 9,7; Daniel 9,8) in uns hervorruft, doch es gibt ebenso unaufhörlich Ursache für Danksagung und Preis, wie sehr wir uns auch vor dem Angesicht Gottes zu demütigen haben.
Fußnoten


 Download als PDF (DIN A4)
Download als PDF (DIN A4) Download als EPUB
Download als EPUB Download als MOBI
Download als MOBI Modul für theWord (Kommentar)
Modul für theWord (Kommentar)