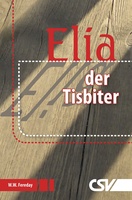Einführende Vorträge zum Matthäusevangelium
Kapitel 17-20

In Kapitel 17 wird uns ein anderer Schauplatz gezeigt, dessen Anblick schon in Matthäus 16,28 einigen der Dabeistehenden verheißen war und der, wenn auch verborgen, mit dem Kreuz in Verbindung stand. Es ist die Herrlichkeit Christi. Es ist nicht so sehr die Herrlichkeit als Sohn des lebendigen Gottes, sondern vielmehr diejenige des erhöhten Sohnes des Menschen, der einst hienieden litt. Nichtsdestoweniger verkündete auch in dieser Entfaltung der Herrlichkeit des Königreiches die Stimme des Vaters Ihn als seinen eigenen Sohn und nicht nur als den verherrlichten Menschen. Es war natürlich das Reich Christi als Mensch, doch Er blieb dabei Gottes eigener Sohn, sein geliebter Sohn, an dem Er Wohlgefallen gefunden hatte. Jetzt sollte man Ihn hören und nicht Moses und Elias, welche verschwinden, um Ihn mit den ausgewählten Zeugen allein zu lassen.
Danach offenbarte sich der traurige Zustand der Jünger am Fuß des Berges, wo Satan in dem gefallenen und ruinierten Menschen herrschte. Trotz aller Herrlichkeit Jesu, des Sohnes Gottes und Sohnes des Menschen, bewiesen die Jünger, dass sie nicht wussten, wie sie seine Gnade für andere Menschen nutzen konnten. Dabei war das doch ihre eigentliche Aufgabe hienieden! Der Herr zeigt jedoch in diesem Kapitel, dass es nicht allein darauf ankommt, was Er getan und was Er erlitten hat, bzw. was bald geschehen wird. Es kommt vor allem auch darauf an, was Er war, was Er ist und was Er immer sein wird. Das offenbarte sich in ganz besonders gesegneter Weise durch das Versagen der Jünger. Petrus, der gute Bekenner von Kapitel 16, macht eine traurige Figur in Kapitel 17; denn als man ihn ausforschte, ob sein Lehrer die Steuer bezahle, antwortete er, dass sein Herr sicherlich ein zu guter Jude sei, um das zu vernachlässigen. Doch unser Herr fragte Petrus mit Würde: „Was dünkt dich, Simon?“ Er bekundete, dass zu derselben Zeit, als Petrus die Erscheinung und die Stimme des Vaters vergaß und Ihn praktisch auf den Boden eines einfachen Menschen stellte, Er Gott, offenbart im Fleisch, blieb. Es ist immer so. Gott erweist, was Er ist, in der Offenbarung Jesu. „Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt zu ihm: Von den Fremden. Jesus sprach zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, tu sein Maul auf, und du wirst einen Stater finden; den nimm und gib ihnen für mich und dich“ (V. 25–27). Ist es nicht sehr schön, wenn wir sehen, dass Er, der sofort seine göttliche Herrlichkeit bewies, uns mit sich verbindet? Wer, außer Gott, konnte nicht nur den Wellen, sondern auch den Fischen des Sees gebieten? Selbst die großzügigste Gabe, die Gott jemals dem gefallenen Menschen auf der Erde gegeben hatte, und zwar dem goldenen Haupt der Nationen (Dan 2), umfasste nicht die Tiefe der Wasser und ihre ungezähmten Bewohner. Wenn Psalm 8 weiter geht, dann gewiss für den Sohn des Menschen, der, weil Er den Tod erlitten hatte, erhöht wurde. Ja, es ist sein Teil, genauso das Meer zu beherrschen und ihm und seinen Geschöpfen zu befehlen wie dem Land und allem, was darauf lebt. Er brauchte dazu auch nicht auf seine Erhöhung als Mensch zu warten; denn Er war immer Gott und Gottes Sohn, der darum, wenn man so sagen darf, auf nichts – auf keinen Tag der Herrlichkeit – warten musste. Auch die Art und Weise ist bemerkenswert. Eine Angel wurde in den See geworfen, und der Fisch, der sie annahm, brachte das erforderliche Geld für Petrus und seinen gnädigen Lehrer und Herrn. Einen Fisch würde wohl kein Mensch zu seinem Bankier machen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er wusste, wie Er in bewunderungswürdiger Weise in einer einzigen Handlung sowohl göttliche Herrlichkeit, die unwiderlegbar verteidigt wurde, als auch demütigste Gnade in einem Menschen verschmelzen konnte. Und so dachte Er, dessen Herrlichkeit von seinem Jünger vergessen wurde, Jesus, an gerade jenen Jünger und sagte: „Für mich und dich.“
Das 18. Kapitel nimmt die beiden Gedanken bezüglich des Reiches und der Versammlung wieder auf. Es zeigt die Bedingung für den Eintritt in das Reich und die Entfaltung der göttlichen Gnade und ihre Anwendung in lieblichster Weise – und zwar in der Praxis. Das Vorbild ist der Sohn des Menschen, wie Er Verlorene rettet. Er führt nicht das Gesetz ein, um das Reich zu regieren oder die Versammlung (Kirche) zu leiten. Die beispiellose Gnade des Heilandes muss hinfort die Heiligen formen und gestalten. Am Ende des Kapitels wird im Gleichnis die unbegrenzte Vergebung, die dem Reich angemessen ist, vorgestellt. Ich kann nicht anders, als hier in die Zukunft zu schauen, wo diese Wahrheit in Vollkommenheit erfüllt wird; aber sie hat auch ihre besondere Bedeutung für die sittlichen Bedürfnisse der Jünger damals und immer. Im Königreich wird die Vergeltung umso schonungsloser sein, je mehr die Gnade verachtet oder missbraucht wurde. Alles dreht sich darum, was zu einem solchen Gott, dem Geber seines eigenen Sohnes, passt. Wir brauchen dabei nicht zu verweilen.
Kapitel 19 bringt eine andere wichtige Belehrung. Wie erhaben auch immer die Kirche oder das Königreich sein mögen – genau zu der Zeit, als der Herr seine neue Herrlichkeit in beiden entfaltete, hielt Er die natürliche Sittsamkeit in ihren Rechten unantastbar aufrecht. Es gibt keinen größeren Fehler als die Annahme, dass Gott wegen der reichen Entwicklung seiner Gnade in den neuen Dingen die natürlichen Beziehungen und ihre Autorität an ihren Plätzen aufgibt oder abschwächt. Das ist, denke ich, eine große Lektion, die zu oft vergessen wird. Beachten wir, dass das Kapitel damit beginnt, die Heiligkeit der Ehe zu verteidigen! Zweifellos ist es ein Band der Natur, das nur für dieses Leben gilt. Nichtsdestoweniger hält der Herr es aufrecht und reinigt es von allen Zusätzen, die hinzugekommen sind und seinen ursprünglichen und besonderen Charakter verdunkeln. So beeinträchtigen die neuen Offenbarungen der Gnade in keinster Weise das, was Gott früher in der Natur eingesetzt hatte. Im Gegenteil, sie verleihen diesen Beziehungen eine neue und größere Bedeutung, indem sie den wahren Wert und die Weisheit der Wege Gottes sogar in diesen geringsten Umständen bestätigen.
Ein ähnlicher Grundsatz wird auch auf die kleinen Kinder, die als nächstes eingeführt werden, angewandt. Ja, er gilt im Wesentlichen für alle natürlichen oder sittlichen Beziehungen hienieden. Gerade weil die Gnade das ausdrückt, was Gott für eine ruinierte Welt ist, wird den Eltern, den Jüngern und in gleicher Weise den Pharisäern gezeigt, dass die Gnade Kenntnis von dem nimmt, was der Mensch in seiner eingebildeten Würde für völlig bedeutungslos hält. Bei Gott ist nicht nur alles möglich, sondern es wird auch niemand, ob klein oder groß, verachtet. Alles wird an seinem rechten Platz gesehen und dorthin gestellt; und die Gnade, welche den Stolz des Geschöpfes zurechtweist, kann es sich leisten, sowohl mit dem Kleinsten als auch mit dem Größten göttlich zu handeln.
Ein Vorrecht sollte uns ganz besonders offenbar geworden sein, nämlich jenes, welches wir bei und in Jesus gefunden haben. So können wir jetzt sagen: Nichts ist für uns zu groß und nichts für Gott zu klein. Außerdem finden wir dort Raum für die tiefste Selbstverleugnung. Die Gnade formt die Herzen derjenigen, die das verstehen, entsprechend der großen Offenbarung dessen, was Gott und auch was der Mensch ist, wie es sich in der Person Jesu gezeigt hat. Das sehen wir ganz deutlich in der Annahme der kleinen Kinder. In dem Folgenden wird es gewöhnlich nicht so leicht erkannt. Der reiche junge Oberste (Lk 18,18) war nicht bekehrt. Weit davon entfernt, konnte er in der Probe, auf die Christus ihn in seiner Liebe stellte, nicht bestehen. Zuletzt, wird uns erklärt, „ging er betrübt weg“ (V. 22). Er war unwissend über sich selbst, weil er unwissend über Gott war. Er bildete sich ein, dass das Problem nur darin bestände, was der Mensch für Gott Gutes tue. Daran hatte er, wie er sagte, von Jugend an gearbeitet. „Was fehlt mir noch?“ (V. 20). Er hatte das Empfinden, irgendetwas Gutes nicht getan zu haben. Wegen dieses Makels wandte er sich an Jesus, damit ihm abgeholfen werde. Wenn man alles um des himmlischen Schatzes willen aufgibt, um zu dem verachteten Nazarener zu kommen und Ihm nachzufolgen – was ist das im Vergleich zu dem, was Jesus auf die Erde herab führte? Das war jedoch viel zu viel für den jungen Mann. Wir sehen das Geschöpf, wie es sein Bestes tut, aber dabei beweist, dass es das Geschaffene mehr liebt als den Schöpfer. Jesus erkannte nichtsdestoweniger alles Anerkennenswerte in ihm an.
Nach diesem wird in unserem Kapitel aufgezeigt, wie sehr das, was der Mensch gut nennt, ein Hindernis darstellt. „Wahrlich, ich sage euch: Schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen“ (V. 23). Das stellt klar, dass diese Schwierigkeit nur von Gott gelöst werden kann. Dann rühmte sich Petrus, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen Jünger. Der Herr bestätigte völlig, dass Er nichts vergisst und alles, was durch die Gnade in Petrus oder den anderen hervorgebracht worden war, anerkennt. Er öffnete jedoch dieselbe Tür für einen jeden, der seine eigene Natur um des Herrn willen verleugnet. Schließlich fügte Er die ernsten Worte hinzu: „Aber viele Erste werden Letzte, und Letzte Erste sein“ (V. 30). Zum Abschluss des Kapitels erfahren wir also, dass jede Sinnesart und das Maß all dessen, was wir um Seinetwillen aufgeben, seine würdige Belohnung und die entsprechenden Resultate finden wird. Doch der Mensch kann das genauso wenig beurteilen, wie er seine Errettung bewirken kann. Es treten für uns unerklärliche Veränderungen in der Reihenfolge auf: „Viele Erste werden Letzte, und Letzte Erste sein.“
Am Anfang des nächsten Abschnitts (Kap. 20,1–28) steht nicht der Lohn im Vordergrund, sondern das Recht und der Anspruch Gottes, nach seiner Güte zu handeln. Er ist nicht bereit, sich zu einem menschlichen Maßstab herabzulassen. Der Richter der ganzen Erde wird recht handeln (vgl. 1. Mo 18,25). Aber wie wird Er handeln, der doch der Geber alles Guten ist? „Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. […] Und als die um die elfte Stunde Angeworbenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden; doch empfingen auch sie je einen Denar“ (V. 1–10). Der Herr behauptet sein souveränes Recht, Gutes zu tun und mit seinem Eigentum zu verfahren, wie Er es will. Die erste dieser Lektionen besteht darin: „Viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein“ (Mt 19,30). Damit wird eindeutig auf ein Versagen der menschlichen Natur angespielt, das zur Umkehrung dessen führt, was man erwarten konnte. Die zweite Lektion ist: „So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. [Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte]“ (V. 16). Das ist die Macht der Gnade. Gott erfreut sich daran, die Letzten für den ersten Platz auszuwählen, um die Ersten nach der eigenen Kraft herabzusetzen.
Zuletzt tadelte der Herr den Ehrgeiz der Söhne des Zebedäus und damit in Wirklichkeit auch den der zehn anderen Jünger; denn warum sonst entstand eine solch lebhafte Entrüstung gegen die beiden Brüder? Warum nicht Kummer und Scham darüber, dass sie so wenig die Empfindungen ihres Lehrers kannten? Wie oft verrät sich das Herz nicht nur durch das, was wir erbitten, sondern auch durch unsere unpassenden Gefühle gegen andere Leute und ihre Fehler! Tatsächlich richten wir uns selbst, wenn wir andere richten.
Hier schließe ich heute Abend. Ich komme jetzt zur endgültigen Krise, das ist die letzte Vorstellung unseres Herrn an Jerusalem. Ich habe, wenn auch nur flüchtig – und, wie ich fühle, sehr unvollkommen – versucht, die Beschreibung des Heilandes zu erläutern, zu welcher der Heilige Geist Matthäus befähigt hat. Im nächsten Vortrag hoffe ich, den Rest seines Evangeliums zu behandeln.
In Kapitel 20,29–34 wird uns von der letzten Präsentation des Herrn an Jerusalem berichtet. Sie begann bei der Stadt Jericho, der einstigen Festung der Macht der Kanaaniter. Der Herr Jesus offenbarte sich in Gnade und besiegelte nicht den Fluch, der über sie ausgesprochen worden war (Jos 6,26). Im Gegenteil, Er machte sie zu einem Zeugen seiner Barmherzigkeit gegen jene, die in Israel glaubten. Dort saßen zwei Blinde (denn Matthäus zeigt, wie wir gesehen haben, häufig diese doppelten Erweise von der Gnade des Herrn) am Wegrand und riefen der Situation angemessen aus: „Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!“ (V. 30). Sie waren von Gott angeleitet und belehrt. Es ging hier nicht um das Gesetz, sondern um seine Fähigkeit als Messias. Ihr Appell stimmte völlig mit der Szene überein. Sie fühlten, dass die Nation kein Empfinden für ihre eigene Blindheit hatte und wandten sich folglich an den Herrn, der sich an dem Ort vorstellte, wo in alten Tagen die Macht Gottes gewirkt hatte. Es ist auffallend, dass trotz der in Israel von Zeit zu Zeit geschehenen Zeichen und Wunder, in denen Kranke geheilt und sogar Tote auferweckt und Aussätzige gereinigt wurden, wir niemals vor dem Auftreten des Messias davon hören, dass Blinde das Sehvermögen geschenkt bekamen. Die Rabbiner sind der Auffassung, dass dies dem Messias vorbehalten sei; und ich weiß von keinem Fall, der ihrer Ansicht widerspricht. Sie scheinen ihre Meinung auf die bemerkenswerte Prophezeiung Jesajas (Jes 35,6) zu gründen. Ich möchte nicht bestätigen, dass diese Prophezeiung einen Grund liefert, diese Art des Wunders von den übrigen abzusondern. Aber es ist ganz offensichtlich, dass der Geist Gottes nachdrücklich die Öffnung von blinden Augen mit dem Sohn Davids verbindet als Teil des Segens, den Er ausgießen wird, wenn Er kommt, um über die Erde zu herrschen.
Hier fällt auch auf, dass Jesus die Segnung nicht bis zur Zeit seiner Herrschaft zurückhält. Zweifellos gab der Herr in jenen Tagen Zeichen und Wunder des zukünftigen Zeitalters (Heb 6,5); und seine Knechte setzten später dieses Werk fort, wie wir am Ende des Markusevangeliums, in der Apostelgeschichte usw. sehen. Die Wunderkräfte, die Er ausübte, waren Muster von der Macht, welche die Erde mit der Herrlichkeit Jahwes erfüllen, den Feind austreiben und die Spuren seiner Macht auslöschen wird, um die Erde zum Schauplatz der Offenbarung seines Königreiches hienieden zu machen. So bewies unser Herr, dass die Macht in Ihm schon anwesend war und dass die Bedürftigen dadurch, dass das Reich im vollsten Sinn des Wortes noch nicht gekommen war, keinen Mangel leiden mussten; denn das Reich war in seiner Person gewissermaßen schon da, wie es von Matthäus (Mt 12,28) und auch Lukas (Lk 17,21) gesagt wird. Auch wurde der Segen für die Söhne der Menschen nicht zurückgehalten. Von seiner königlichen Berührung ging Kraft aus. Diese war auf jeden Fall nicht von der Anerkennung seiner Rechte seitens seines Volkes abhängig. Er führte jenes Zeichen der messianischen Gnade – das Öffnen der blinden Augen – aus. Es war in sich selbst kein geringes Zeichen von dem wahren Zustand der Juden, wenn sie es nur gefühlt und anerkannt hätten! Ach, sie fragten nicht nach Barmherzigkeit und Heilung von seiner Hand! Aber wenn in Jericho irgendjemand war, der Ihn anrief, dann wollte der Herr hören. Hier antwortete der Messias also auf den Ruf des Glaubens dieser beiden Blinden. Als die Volksmenge sie bedrohte, damit sie schwiegen, schrieen sie umso mehr. Schwierigkeiten, die dem Glauben gemacht werden, lassen die Stärke seines Verlangens nur noch mehr anwachsen. Und so riefen sie: „Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!“ (V. 31). Jesus blieb stehen, rief die Blinden und fragte: „Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?“ „Herr, dass unsere Augen aufgetan werden!“ (V. 32.33). Und es geschah so nach ihrem Glauben. Darüber hinaus wird angemerkt, dass sie Ihm folgten. Das ist ein Unterpfand von dem, was geschehen wird, wenn das Volk einst seine Blindheit anerkennt und sich an Ihn wendet, um Augenlicht von dem wahren Sohn Davids zu empfangen, um Ihn am Tag seiner irdischen Herrlichkeit sehen zu können.

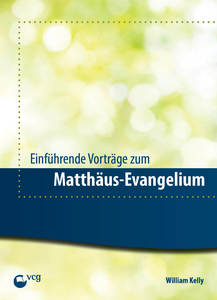
 Download als PDF (DIN A4)
Download als PDF (DIN A4) Download als EPUB
Download als EPUB Download als MOBI
Download als MOBI Modul für theWord (Kommentar)
Modul für theWord (Kommentar) Lectures Introductory - Gospel of Matthew
Lectures Introductory - Gospel of Matthew