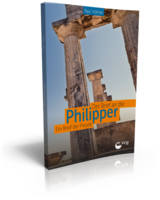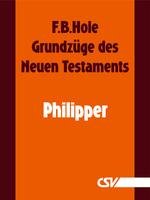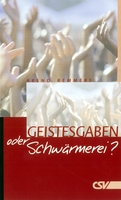Das Lebensziel bestimmt den Lebensstil
Der Brief an die Philipper – Vers für Vers erklärt
Kapitel 4: Christus unsere Kraft

Kapitel 2 hat uns mit der Gesinnung des Herrn Jesus auf der Erde beschäftigt. Seine Gesinnung soll jetzt in uns sichtbar werden, während wir ein Zeugnis für Ihn sind. Kapitel 3 hat uns Christus als das Ziel unseres Weges vorgestellt. Er ist jetzt der verherrlichte Mensch im Himmel und kommt bald zurück. Der Blick auf Ihn gibt uns Kraft, Ihm jetzt zu folgen und auf Ihn zu warten.
Damit ist der Hauptteil des Briefs abgeschlossen. Dennoch folgt ein weiteres und wichtiges Kapitel. Paulus ging seinen Weg auf der Erde mit Christus. Er kannte Ihn als das Ziel vor Augen. Aus dem Wissen um die Schwierigkeiten des Weges einerseits und der Kenntnis von Christus andererseits gibt er nun wichtige praktische Hinweise und macht deutlich, dass Christus für alle Umstände des Lebensweges eines Christen völlig genügt.
Die praktischen Hinweise kommen aus einem Herzen, das einerseits in seinem Herrn zur Ruhe gekommen war und das andererseits in Liebe für die Gläubigen schlug. Paulus macht deutlich, wie man trotz schwieriger äußerer Umstände im Frieden Gottes seinen Weg gehen kann. Paulus war den Umständen des Lebens und den Gefahren gegenüber keineswegs gefühllos oder unempfindlich, dennoch lag er nicht unter den Umständen, sondern stand in einer gewissen Weise innerlich darüber. Nichts konnte seinen Frieden beeinträchtigen. Er kannte den, in dem er alles tun konnte. „Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt“ (Phil 4,13). Es ist wie eine Kernaussage des ganzen Briefs. Christus genügt für alles.
Die Struktur des Kapitels ist wie folgt:
- Verse 1–9: Praktische Hinweise für das tägliche Leben
- Verse 10–18: Die Gabe der Philipper und die Umstände des Paulus
- Verse 19.20: Paulus vertraut und ehrt Gott
- Verse 21–23: Grußworte
Vers 1: Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte!
Eine besondere Anrede
Der Ausdruck daher verbindet den praktischen Teil von Kapitel 4 unmittelbar mit dem Ende von Kapitel 3. Dort ging es einerseits um die Feinde des Kreuzes Christi und andererseits um das Kommen des Herrn mit seinen herrlichen Folgen.
Die Anrede in diesem Vers muss uns auffallen. Sie ist einmalig. Paulus redet die Philipper als Brüder (Geschwister) an, er spricht von seiner Liebe und seiner Sehnsucht zu ihnen, er nennt sie seine Freude und seine Krone und am Ende noch einmal Geliebte.
- Meine geliebten Brüder: Diese Worte zeigen erneut die innige Beziehung innerhalb der Familie Gottes. Die Philipper waren nicht nur seine Brüder (Kap. 3,1; 3,17), sondern er liebte sie mit der Liebe Gottes.
- Meine ersehnten Brüder: Mit dieser Anrede äußert Paulus das Verlangen, das er nach ihnen hatte. Die Worte erinnern an Kapitel 1,8, wo Paulus geschrieben hatte: „Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu“. Die Philipper gaben Paulus Anlass, sie so anzureden. Die Gemeinschaft der Gedanken, ihr Eifer, ihre Hingabe und Liebe zu dem Herrn und zu Paulus sowie ihre Treue waren der Anlass dafür.
- Meine Freude und Krone: Diese Formulierung bildet eine Einheit. Freude war das gegenwärtige Empfinden von Paulus, wenn er an die Philipper dachte. Es ging ihm wie Johannes, der schreibt: „Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln“ (3. Joh 4). Die Krone ist nicht die Herrscherkrone, sondern die Siegerkrone. Sie spricht von dem Lohn, den der Herr am Richterstuhl des Christus austeilen wird. Paulus richtet seinen Blick in die Zukunft und sieht diesen Lohn vor sich. Die Krone würde der Beweis dafür sein, dass Paulus nicht vergeblich gelaufen war (Kap. 2,16). Ähnlich drückt er sich in 1. Thessalonicher 2,19 aus: „Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft?“
Feststehen im Herrn
Nach der liebevollen Anrede im brüderlichen Ton folgt nun eine klare Aufforderung. Paulus wiederholt das, was er in Kapitel 1,27 bereits gesagt hatte: Steht fest im Herrn. Angesichts falscher Lehrer, angesichts aller Angriffe gegen die Wahrheit, angesichts der Aktivität des Feindes ist es wichtig, dass die Gläubigen feststehen. Feststehen meint nichts anderes, als im Herrn stark zu sein. In Ihm sollen wir stehen wie „ein Fels in der Brandung“. Das können wir niemals in eigener Kraft, sondern nur „im Herrn“. Er ist es, der die Kraft dazu gibt. Er ist der auferstandene Herr zur Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron Gottes, der durch nichts und niemand erschüttert werden kann. Wie immer die Umstände sein mögen: Sie bewegen das Herz unseres Herrn, niemals jedoch seinen Thron. Deshalb können wir in dem Bewusstsein, Geliebte zu sein, in Ihm feststehen.
Vers 2: Evodia ermahne ich, und Syntyche ermahne ich, gleich gesinnt zu sein im Herrn.
Eine ernste Aufforderung
Paulus kommt nun auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Nach dem Appell zur Standhaftigkeit folgt der Appell zur Einmütigkeit. Differenzen untereinander können die Standhaftigkeit im Herrn leicht ins Wanken bringen, und wenn man nicht im Herrn feststeht, ist die Einmütigkeit in Gefahr. Die Ermahnung ist persönlich und deutlich. Dennoch ist sie liebevoll vorgebracht. Sie trägt den Charakter einer Aufforderung und gleichzeitig einer Bitte.
Wir haben bereits gesehen, wie Paulus mehrfach die Problematik mangelnder Einmütigkeit angedeutet hat. Nun spricht er diese Schwierigkeit direkt an. Es ging um zwei Schwestern, die Meinungsverschiedenheiten und Differenzen hatten. Die beiden werden namentlich erwähnt. Details kennen wir nicht. Sie sind nicht erforderlich. Gott will an dieser Stelle eine allgemeine Belehrung geben.
Evodia und Syntyche waren zwei Schwestern der Versammlung in Philippi. Evodia (Euodia) bedeutet „wohlgeratener Weg“ oder „Wohlgeruch“ und Syntyche „vom Glück begünstigt“ oder „glücklicher Sieg“. Aus der Bedeutung der Namen sollte man in diesem Fall nicht zu viel ableiten, denn es waren vermutlich ungläubige griechische Eltern, die ihnen diese Namen gegeben hatten.
Paulus spricht die beiden Schwestern persönlich an. Es handelte sich nicht nur um eine „private“ Sache zwischen den beiden, sondern die Angelegenheit ging alle an. Paulus ergreift in keiner Weise Partei für die eine oder andere Seite, sondern richtet die Herzen auf den Herrn hin. Er ermahnt sie, gleich gesinnt zu sein im Herrn. Der Blick auf den Herrn ist immer die Lösung für unsere Probleme. Es ist – unter Berücksichtigung der Aussage des nächsten Verses – denkbar, dass die beiden Schwestern unterschiedliche Gedanken über den Dienst für den Herrn hatten und dass dies die Ursache ihrer Meinungsverschiedenheit war. Paulus kannte so etwas aus eigener Erfahrung. Zwischen ihm und seinem Reisegefährten Barnabas war es ebenfalls einmal zu einer „Erbitterung“ gekommen, die nicht sogleich gelöst werden konnte (Apg 15,39). Einsatz für den Herrn bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen. Gerade dann, wenn wir uns im Werk des Herrn einbringen, wird der Feind aktiv werden, und eine seiner Strategien besteht darin, Uneinigkeit unter Mitarbeitern zu säen. Deshalb ist es gerade im Dienst für den Herrn wichtig, dass wir „Schulter an Schulter“ stehen. Wenn Probleme auftreten, wird der Herr verunehrt, und der Dienst leidet. Der Herr sucht nicht nur „Arbeiter“, sondern „Mitarbeiter“.
Die Aufforderung lautet gleich gesinnt zu sein im Herrn. Es ist das Wort, das wir bereits mehrfach in unserem Brief gefunden haben. Sie sollten „die gleiche Denkrichtung haben“. Das meint nicht, dass sie über alle Dinge des täglichen Lebens gleich denken sollten, wohl aber, dass sie in den Angelegenheiten des Herrn nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten sollten. Es gibt im Dienst für den Herrn ein gemeinsames Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Uneinigkeit beschäftigt uns miteinander, und darunter wird immer die Arbeit für den Herrn leiden. Selbst wenn es nur vermeintliche „Kleinigkeiten“ sind, sollten wir bedenken, dass ein kleines Feuer einen großen Wald anzünden kann. Hohelied 2,15 spricht von den kleinen Füchsen, die gefangen werden müssen, bevor sie den ganzen Weinberg verderben. Salomo schreibt: „Der Anfang eines Zankes ist wie die Entfesselung von Wasser; so lass den Streit, ehe er heftig wird“ (Spr 17,14). Man kann ein Problem am besten sofort lösen, wenn es noch nicht groß ist.
Die Einmütigkeit muss im Herrn sein. Es ist völlig klar, dass wir Einmütigkeit nur dann erreichen, wenn wir aufrichtig den Willen unseres Herrn suchen und unseren eigenen Willen hinten anstellen. Nur wenn unser Verhältnis zum Herrn stimmt, wird unser Verhältnis untereinander stimmen. In der persönlichen Demut und der Nähe zum Herrn können persönliche Streitigkeiten vermieden werden. Dann stehen wir fest im Herrn, und sind mild, wenn es um unsere eigene Meinung geht.
Vers 3: Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.
Hilfe und Unterstützung
Wir haben schon bemerkt, dass Paulus keine Partei ergreift. Er fordert zunächst die beiden Schwestern auf, ihr Problem zu lösen. Gleichzeitig bittet er nun seinen treuen Mitknecht, den beiden zu helfen. Es ist kein Befehl oder eine Aufforderung, sondern eine Bitte. Paulus macht das Problem zwar öffentlich, dennoch ist es nicht gleichzeitig ein „Versammlungsthema“. Ein einzelner Bruder sollte Hilfestellung geben. Er sollte nicht „rügen“ oder „tadeln“, sondern den beiden helfen. Es hat sich bis heute häufig als nützlich erwiesen, wenn eine dritte Person da ist und hilft, persönliche Differenzen auszuräumen. Eine solche Person muss unparteiisch sein und ein gesundes geistliches Urteilsvermögen haben. Es war keine einfach zu erfüllende Bitte, die Paulus ausspricht. Schon Salomo schreibt: „Zwistigkeiten sind wie der Riegel einer Burg“ (Spr 18,19). Einen solchen Riegel zu „knacken“ ist immer eine besondere Herausforderung und nur mit der Hilfe von oben möglich.
Es ist nicht eindeutig, wer der angesprochene treue Mitknecht ist. Wörtlich übersetzt bedeutet der Ausdruck „Jochgenosse“ („Zusammengejochter“). Das Wort kommt nur hier vor. Einige Ausleger nehmen an, dass es sich um einen Eigennamen handelt, d. h. um einen Bruder mit Namen „Synzugus“ oder „Suzugos“ (Mitknecht). Sprachlich ist das möglich. Dennoch zieht die Mehrzahl bibeltreuer Ausleger es vor, hier an Epaphroditus zu denken, über den Paulus bereits in Kapitel 2 ausführlich gesprochen hatte. Paulus schätzte diesen Bruder sehr. Er nennt ihn einen „treuen Mitknecht“. Treu bedeutet „echt“. Das Wort wurde damals z. B. benutzt, um die ehelichen und in der Familie geborenen Kindern von den unehelichen Kindern zu unterscheiden. In 2. Korinther 8,8 wird das Wort gebraucht, um von der „Echtheit“ oder „Aufrichtigkeit“ der Liebe zu sprechen. Die Tatsache, dass Epaphroditus ein „Jochgenosse“ war, zeigt seine Bereitschaft, seine Schultern unter den gleichen Dienst wie Paulus zu beugen. Es war in diesem Fall kein „ungleiches Joch“ (2. Kor 6,14), sondern ein „gleiches Joch“.
Im Evangelium kämpfen
Paulus erwähnt nun, was die beiden Schwestern im Werk des Herrn getan hatten. Sie hatten mit Paulus und anderen im Evangelium gekämpft. Wer Clemens und die übrigen Mitarbeiter sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Entscheidend ist, dass sie zusammen gearbeitet haben. Mitarbeiter zu sein bedeutet, sich gegenseitig zu fördern und daraus einen gemeinsamen Nutzen zu ziehen.
In Kapitel 1,27 hatte Paulus die Philipper aufgefordert, dass sie „mit einer Seele mitkämpfen sollten“ mit dem Glauben des Evangeliums. Kämpfen taten die beiden Schwestern, mit einer Seele leider nicht. Dennoch hebt Paulus ihre Kampfbereitschaft und ihren Einsatz hervor. Worin ihr Einsatz genau bestand, wissen wir nicht. Paulus sagt nicht, dass sie das Evangelium gepredigt haben, sondern er spricht von ihrem Kampf im Evangelium. In Übereinstimmung mit der Lehre des Neuen Testaments können wir sicher sein, dass sie nicht gepredigt haben. Im Evangelium zu kämpfen bedeutet, dass sie bereit waren, Widerstand und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Die beiden waren leidensbereit.
W. Kelly schreibt: „Sie nahmen am Kampf des Evangeliums teil. Sie trugen an der Schande mit, die jene umhüllte, welche es verkündeten. Dieser Gedanke geht bei der Vorstellung von einer Mitarbeit verloren. Wir müssen vielmehr an den Kampf des Evangeliums denken. Alle, die daran beteiligt waren, hatten häufig Schimpf, Leiden und Spott zu erdulden.“ 1
Paulus hatte die Bereitschaft der beiden Schwestern nicht vergessen. Er schätzte sie. Bis heute ist dieser Vers eine besondere Motivation gerade für Schwestern, die sich auf ihre Weise ebenso im Kampf für das Evangelium engagieren sollen wie ihre Brüder.
Das Buch des Lebens
Paulus erwähnt das Buch des Lebens. Es ist klar, dass es sich dabei nicht um eine tatsächliche (materielle) Buchrolle im Himmel handelt. Der Begriff ist bildhaft zu verstehen. Es ist ein Buch (ein „Verzeichnis“), in dem alle stehen, die Leben aus Gott haben. Es macht klar, dass Gott diejenigen genau kennt, die durch den Glauben an den Herrn Jesus ewiges Leben haben und Ihm angehören.
Bereits im Alten Testament finden wir ähnliche Hinweise in Jesaja 4,3 und Daniel 12,1.2. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke ebenfalls mehrfach erwähnt (Lk 10,20; Off 3,5; 21,27; Heb 12,23). Wer in diesem Buch im Himmel eingeschrieben ist, wird nie wieder ausgelöscht werden. Diese Sicherheit bestätigt der Herr Jesus z. B. in Johannes 10,27.28: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben“. In Offenbarung 3,5 lesen wir: „Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens“. Dieser Vers wird manchmal missverstanden. Er lässt keineswegs die Möglichkeit offen, dass man ausgelöscht werden könnte, sondern die starke Verneinung will gerade das Gegenteil zeigen. Man wird ganz sicher nicht ausgelöscht werden. Es ist unmöglich.
Es stellt sich die Frage, warum Paulus das Buch des Lebens gerade hier (wie es scheint fast beiläufig) erwähnt. Ein Grund mag darin liegen, dass er den besonderen Wert der beiden Schwestern und seiner nicht namentlich genannten Mitarbeiter unterstreichen will.
A.C. Gaebelein schreibt: „Es ist dem Diener genug zu wissen, dass sein Name, auch wenn er in dieser Welt unbekannt ist, im Buch des Lebens angeschrieben ist und dass sein Dienst, auch wenn er in der Welt keinen Beifall findet, seine Zustimmung hat.“ 2
Für Gott hat jeder Name einen großen Wert. Deshalb sollten wir nie gering über jemand denken oder reden, dessen Name dort eingeschrieben ist. Ein weiterer Grund mag sein, dass Paulus deutlich machen will, dass die Feinde des Evangeliums zwar manches tun mögen, doch kein Widerstand auf dieser Welt kann je einen einzigen Namen aus dem Buch des Lebens löschen. Das gibt uns Sicherheit im Kampf im Evangelium.
Vers 4: Freut euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!
Freude im Herrn
Es wundert uns nicht, dass Paulus in dem Brief wiederholt zu Freude aufruft und von Freude spricht Kap. 1,18; 2,17.18.28; 3,1). Die Wiederholung unterstreicht, wie wichtig es ihm ist, dazu aufzufordern. Hier wird indes das Wort allezeit hinzugefügt. Das will sagen: „Freut euch immer. Freut euch in allen Umständen.“ Die Freude im Herrn ist keine zeitlich begrenzte Aufwallung von Gefühlen. Sie ist keine „menschliche“ Freude, sondern etwas, das nur der Heilige Geist in uns hervorbringen kann. Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes (Gal 5,22). Trotz aller Angriffe von außen, trotz des Versagens im Innern und trotz schwieriger Umstände, kann und soll die Freude im Herrn dennoch dauerhaft sein. Der Grund ist, dass sie nicht von den Lebensumständen abhängig ist. Die Freude im Herrn gleicht einer geschützten Kerze in stürmischer Nacht. Ohne schützendes Glas würde sie sofort ausgehen.
Wir wissen sehr wohl, dass dies leicht gesagt und schwierig zu verwirklichen ist, doch gerade der Schreiber dieser Worte – Paulus – ist authentisch. Er hat es praktiziert. Für ihn war es keine Theorie, sondern gelebte Praxis. Deshalb kann er andere dazu auffordern. Er schreibt diese Worte nicht, während (oder unmittelbar nachdem) er in den dritten Himmel entrückt war. Er schreibt sie aus einem Gefängnis, wo es in den Umständen wohl kaum Freude gab. Seine Freude konnte nur im Herrn sein. Den Korinthern schreibt er: „… als Traurige, aber allezeit uns freuend“ (2. Kor 6,10).
Nach der Aufforderung, festzustehen „im Herrn“ (V. 1) und gleichgesinnt zu sein „im Herrn“ (V. 2), folgt nun also der Appell zur Freude „im Herrn“ (V. 4). Jemand hat einmal gesagt: „Wenn wir nahe beim Herrn sind und ihm anhangen, wird unsere Freude durch ihn geheiligt und das Empfinden unserer Schwierigkeiten gemildert, weil wir sie mit ihm durchleben“. Der Herr ist Quelle und das Geheimnis dieser Freude. Er gibt die Kraft dazu. J.N. Darby schreibt: „In Ihm findet der Christ das, was durch nichts verändert werden kann. Das ist nicht Gleichgültigkeit dem Schmerz gegenüber – sie würde das Weinen verhindern –, sondern Christus ist für ihn eine Quelle der Freude. Sie erweitert sich, wenn Betrübnis vorhanden ist, weil sie unveränderlich ist. Sie wird umso reiner im Herzen, je mehr sie allein das Herz aus füllt; und sie ist in sich selbst die einzige Quelle, die endlos rein ist … Nichts trübt auch diese Freude, weil Christus sich nie verändert.“ 3
Der Prophet Habakuk beendet seinen Brief mit den Worten: „Denn der Feigenbaum wird nicht blühen, und kein Ertrag wird an den Reben sein; und es trügt die Frucht des Olivenbaumes, und die Getreidefelder tragen keine Speise; aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr, ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Dem Vorsänger. Mit meinem Saitenspiel“ (Hab 3,17-19). Habakuk lebte in notvollen Umständen. Alles sah aussichtslos aus. Dennoch konnte er „in dem Herrn“ frohlocken.
Der Zusatz wiederum will ich sagen: freut euch ist nicht eine einfache Wiederholung, sondern unterstreicht sowohl die Notwendigkeit der konstanten Freude sowie deren Wachstum und Steigerung.
Vers 5: Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen; der Herr ist nahe.
Milde
Milde (wörtlich: das Gelinde) enthält den Gedanken an Nachgiebigkeit und an die Bereitschaft, den eigenen Weg und die eigene Position aufzugeben. Milde schließt ein, dass wir nicht auf unseren vermeintlichen Rechten bestehen. Titus sollte die Gläubigen daran erinnern, milde zu sein (Tit 3,2). Jakobus 3,17 zeigt uns die Milde als ein Merkmal der Weisheit, die von oben kommt. Milde zu sein bedeutet nicht, Kompromisse in Bezug auf die Wahrheit einzugehen. Milde ist keine Schwäche. Wenn es allerdings um Meinungsverschiedenheiten (z. B. unter Gläubigen) geht, ist Milde angesagt. Salomo schreibt: „Eine milde Antwort wendet den Grimm ab“ (Spr 15,1). Milde ist das Gegenteil von Selbstsucht und Streitsucht. W. Kelly schreibt dazu: „Dieses ist die Sanftmut und Milde, die sich jedem Schlag beugt, anstatt ihm in einem Geist zu widerstehen, der stets auf seine Rechte besteht und für sie kämpft.“ 4
Paulus erinnert die Korinther daran, dass er sie durch die „Sanftmut und Milde des Christus“ ermahnen wollte (2. Kor 10,1). Milde ist also eine Eigenschaft, die wir deutlich im Leben des Herrn Jesus sehen. Ein Beispiel von vielen finden wir in Lukas 9,51-55. Als er mit seinen Jüngern nach Jerusalem ging, verweigerte man ihm unterwegs in Samaria die Gastfreundschaft. Als daraufhin die Jünger Feuer vom Himmel fallen lassen wollten, machte er ihnen klar, dass dies keine angemessene Reaktion war. Er tadelt sie und geht in ein anderes Dorf. Die Jünger zeigen – ganz im Gegensatz zu ihrem Meister – in dieser Situation keine Milde.
Wir sollen diese Milde allen Menschen kundwerden lassen. Das tun wir nicht so sehr durch unsere Worte, sondern vielmehr durch unser Verhalten. Wir sollen nicht so viel über Milde reden, sondern sie praktizieren. Die Menschen – Gläubige und Ungläubige – sollen sehen, dass wir uns in Umstände fügen können, dass wir nicht aufbegehren und nicht auf unseren vermeintlichen Rechten bestehen. Das spricht direkt in den Lebensalltag hinein. Gerade in einer Welt, wo viele Menschen auf ihren Rechten bestehen und sie durchzudrücken versuchen, zeigen wir diese Tugend der Milde.
Der Herr ist nahe
Der Herr ist nahe kann sich sprachlich einerseits auf das Kommen des Herrn beziehen, wenn Er uns zu sich nimmt. Das ist der Augenblick, an dem alle Uneinigkeit ein Ende hat und wir in Harmonie verbunden sind. Dieser Gedanke verbindet sich mit der Aussage am Ende von Kapitel 3. In der Tat wird es nicht mehr lange dauern, bis der Herr kommt. Er hat es selbst versprochen. „Denn noch eine ganz kleine Zeit, und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben“ (Heb 10,37). „Befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen“ (Jak 5,8).
Die Aussage kann sich andererseits darauf beziehen, dass der Herr uns in jedem Augenblick des Lebens nahe ist. Das ist ebenfalls eine Zusage, die Er uns gegeben hat: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“ (Mt 28,20). Er kennt unsere Umstände, und Er wird für uns eintreten. „Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen“; so dass wir kühn sagen können: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten; was wird mir ein Mensch tun?“ (Heb 13,5.6). Wenn Er uns nahe ist, was soll uns dann geschehen? Schon im Alten Testament waren die Glaubenden von diesem Gedanken durchdrungen. „Du bist nahe, Herr“ (Ps 119,151). David wusste: „Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in Wahrheit“ (Ps 145,18). Das ist dann gleichzeitig die Überleitung zum nächsten Vers.
Vers 6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden;
Um nichts besorgt sein
Sorgen gehören zum Leben des Christen dazu. Natürlich gibt es Gläubige, die mehr zum Sorgen neigen als andere. Allen gilt die Aufforderung: Seid um nichts besorgt. Der Herr Jesus selbst belehrt seine Jünger in der Bergpredigt, dass sie nicht besorgt sein sollten. Die Verse sind es wert, zitiert zu werden:
„Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet: dann nicht viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen?, oder: Was sollen wir trinken?, oder: Was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug“ (Mt 6,25-34).
Sich nicht zu sorgen meint nicht,„sorglos“ in den Tag hineinzuleben. Selbstverständlich sind wir verantwortlich für die Dinge des Lebens, die uns begegnen. Sie beschäftigen uns. Doch sie sollen uns nicht mutlos machen. Wir sollen uns nicht völlig von ihnen in Beschlag nehmen lassen. Es gibt einen Ausweg. Der Herr kümmert sich um uns: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch“ (1. Pet 5,7).
Wenn wir diesen Ausweg nicht nutzen und uns die Sorgen des Lebens zu einer „Last“ werden, nimmt die Freude ab. Zugleich wird die Hingabe an den Herrn leiden, wenn wir uns von den Sorgen überwältigen lassen. Das Beispiel von Martha in Bethanien zeigt dies sehr klar. Sie war „besorgt und beunruhigt um viele Dinge“ (Lk 10,40.41), und das hielt sie davon ab, das „gute Teil“ zu erwählen, für das ihre Schwester Maria sich entschieden hatte.
Im Gebet vor Gott
Das Heilmittel ist das Gebet. Während wir unsere Milde allen Menschen kundwerden lassen, sprechen wir über unsere Sorgen mit unserem Gott. Ohne Gebet ist es unmöglich, um nichts besorgt zu sein. In allem steht dabei im Gegensatz zu um nichts. Es gibt nichts in unserem Leben – seien es kleine oder große Dinge –, die unseren Gott nicht interessieren. Er nimmt an allen unseren Bedürfnissen teil. Ja, Er kennt sie besser als wir selbst. Dennoch freut Er sich, wenn wir sie vor Ihm aussprechen.
Es geht an dieser Stelle nicht um ein Gebet „im Namen des Herrn“ (Joh 14,13.14; 15,16; 16,23-26) oder um ein Gebet „nach seinem Willen“ (1. Joh 5,14.15). In diesen Fällen ist uns nicht nur zugesagt, dass Er hört, sondern dass Er uns tatsächlich erhört. Das setzt voraus, dass wir seinen Willen in einer Sache unterscheiden und erkennen. Hier geht es um die Lebensumstände des Christen in dieser Welt, und da liegt uns vieles auf dem Herzen, von dem wir nicht wissen, ob es eine Bitte „nach seinem Willen“ ist. Dennoch darf uns das nicht davon abhalten, es Ihm vorzutragen. Gewiss, je inniger unsere Gemeinschaft mit dem Herrn ist, umso mehr Unterscheidungsvermögen haben wir. Hier geht es jedoch um den Grundsatz, dass wir Ihm „alles“ sagen sollen. Wann und wie Er antwortet, überlassen wir Ihm.
Es ist ein Beweis des Vertrauens, wenn wir das tun. So wie ein Kind, wenn es in einem guten Verhältnis zu seinen Eltern steht, sich mit ihnen über alles austauschen kann, tun wir es mit unserem Gott. Niemand versteht unsere Anliegen und Gedanken so gut wie Er. Es ist nicht so, dass wir zunächst in jeder Sache den Willen Gottes erforschen müssten und dann erst im Gebet zu Ihm kommen können. Nein, Paulus legt ja gerade Wert darauf, dass wir mit unseren Anliegen zu Ihm kommen sollen. Das ist das, was uns gerade in einer bestimmten Situation bewegt. Wir lassen sie kundwerden, d.h. in diesem Fall, dass wir sie aussprechen. Milde lassen wir im Verhalten kundwerden, unsere Anliegen durch unsere Worte.
Anliegen bedeutet wörtlich „das Erbetene“ oder „Dinge, für die man betet“. In 1. Johannes 5,15 wird das Wort mit Bitte übersetzt. Es geht um den Gegenstand, um den wir bitten. Obwohl Gott es bereits weiß, bevor wir es sagen (Ps 139,4), möchte Er, dass wir es aussprechen. Das zeugt von Abhängigkeit und vor allem von unserem Vertrauen zu Ihm. Das Gebet gleicht einem Ventil, durch das wir den Druck unserer Sorgen ablassen können.
Paulus erwähnt Gebet, Flehen und Danksagung. Gebet ist das allgemein gebräuchliche Wort für unser Reden zu Gott (vgl. z. B. 1. Tim 2,1), Flehen meint mehr das anhaltende und intensive Bitten in Verbindung mit einem konkreten Mangel. Gebet und Flehen werden wiederholt miteinander verbunden (vgl. z. B. Eph 6,18; 1. Tim 2,1; 1. Tim 5,5; Ps 6,10). Danksagung soll nicht fehlen. Sie bewahrt das Herz. Der Dank darf dabei keine „Floskel“ sein, sondern soll von Herzen kommen. Danken bewahrt vor Zweifeln und Misstrauen, die uns oft beschleichen, wenn wir etwas von Gott erbitten. Paulus gibt uns ein gutes Beispiel. Sehr oft hat er seine Gebete mit Dank verbunden.
Vers 7: und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.
Der Friede Gottes
Paulus macht jetzt deutlich, was die Folge ist, wenn wir der Aufforderung von Vers 6 nachkommen. Es wird nicht gesagt, dass Gott jedes Gebet erhört und jeden Wunsch erfüllt. Wir können sicher sein, dass Er uns immer hört, aber Er erhört nicht alles. Es gibt viele Dinge, die uns gut und nützlich erscheinen, die aus der Sicht Gottes jedoch nicht gut sind. In seiner Weisheit und seiner Liebe erfüllt Er nicht jeden Wunsch, den wir haben. Es kann sein, dass wir in einer Sache intensiv beten, ohne dass sich die Umstände verändern. Das Anliegen findet keine Erhörung. Dennoch hat das Gebet eine entscheidende Folge: Der Friede Gottes wird uns bewahren, d. h., wir genießen seinen Frieden und haben damit eine andere Wahrnehmung der Umstände als vorher.
Paulus hatte das selbst erlebt. In 2. Korinther 12 lesen wir, dass er dreimal um eine Sache bat, die ihn persönlich betraf. Er hatte einen „Dorn im Fleisch“, der ihm viel Mühe machte. Gott erfüllte seine Bitte nicht, gab ihm jedoch die Zusage seiner Kraft (2. Kor 12,9). Das war für Paulus genug. Der Römerbrief gibt Zeugnis davon, dass Paulus sich mehrfach vorgenommen hatte, nach Rom zu reisen (Röm 1,10; 15,23). Er hatte allezeit in seinen Gebeten darum gefleht. Gott hat seine Bitte zwar erhört, allerdings auf eine ganz andere Weise, als Paulus es sich vorgestellt hatte. Er kam nicht als freier Mann nach Rom, sondern als Gefangener. Dennoch kam er im „Frieden Gottes“.
Den Frieden Gottes zu genießen ist etwas anderes als „Frieden mit Gott zu haben“. In Römer 5,1 lesen wir: „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“. Das gilt für jeden, der dem Evangelium des Heils geglaubt hat. Es ist die sichere Stellung dessen, der gerechtfertigt worden ist. Es ist ein dauerhafter Besitz, den man nicht verlieren kann. Frieden mit Gott zu haben bedeutet, dass nichts mehr zwischen uns und einem heiligen Gott steht. Der Mensch ist von Natur ein Sünder und damit ein Feind Gottes. Unsere Sünden trennen uns von Gott. Wer den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, weiß, dass seine Sünden vergeben sind. Gott hat uns in Christus angenommen. Er hat Ihn für das gestraft, was wir verdient hatten. Durch das Werk am Kreuz und sein vergossenes Blut hat der Herr Jesus Frieden gemacht (Kol 1,20). Jeder, der sein Werk für sich persönlich in Anspruch nimmt, kann deshalb wissen, dass er „Frieden mit Gott“ hat.
In unserem Vers spricht Paulus jedoch von dem Frieden Gottes. Er kennzeichnet unsere Beziehung zu Gott im täglichen Leben. Der Friede Gottes bedeutet für uns Ruhe und Zufriedenheit. Wenn wir diesen Frieden genießen, ist das Innere nicht in Unruhe oder gar Aufruhr, sondern in Ruhe. Gott ist die Quelle dieses Friedens. Der Genuss seines Friedens ist abhängig davon, ob wir Ihm unsere Sorgen überlassen oder nicht. Wir genießen ihn, wenn wir in Gottes Willen ruhen.
Als der Herr Jesus auf der Erde war, hat er den Jüngern gesagt: „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam“ (Joh 14,27). Letzteres kommt dem, was wir hier finden, nahe. Den Frieden, den der Herr uns gelassen hat, können wir in etwa mit dem „Frieden mit Gott“ vergleichen. Er gehört jedem, der Jesus als seinen Heiland angenommen hat. „Mein Friede“ hingegen ist der Friede in den Umständen. Es ist der „Friede des Christus“ (Kol 3,15), der in unseren Herzen regieren soll. Wir können ihn in etwa mit dem Frieden Gottes vergleichen. Allerdings ist zu beachten, dass Paulus in Philipper 4 nicht direkt von dem Frieden des Christus, sondern von dem Frieden Gottes spricht. Während der Friede des Christus ein Friede in schwierigen Umständen ist, ist der Friede Gottes ein Friede, der über den Umständen steht und durch nichts erschüttert werden kann. Unsere Umstände bewegen sehr wohl das Herz Gottes, aber niemals seinen Thron. Er ist über alle Umstände erhaben. Sein Ratschluss steht ewig fest in den Himmeln. Was immer passieren mag, es kann unseren Gott nicht erschüttern.
Einerseits kennen wir also den „Frieden des Christus“, d. h. den Frieden, den Er in den widrigen und feindlichen Umständen auf der Erde stets genossen hat. Das ist der Friede in unseren Umständen. Andererseits kennen wir den „Frieden Gottes“, den wir nicht nur in den Umständen genießen, sondern der uns sogar über die Umstände „erhebt“.
Paulus fügt hinzu, dass der Friede Gottes allen Verstand übersteigt. Der Verstand ist hier der „Sinn“ oder der „Geist“. Durch unseren Verstand sind wir fähig zu denken und zu urteilen. Wenn wir jedoch an den Frieden Gottes denken, empfinden wir schnell, dass er unser Denkvermögen deutlich übersteigt. Es ist etwas, das wir auf der Erde nie wirklich erfassen können.
Der Friede Gottes bewahrt uns
In einer Welt voller Gefahren und Unruhe haben wir Bewahrung nötig. Das Wort bewahren ist ein militärischer Ausdruck. Er wird z. B. in 2. Korinther 11,32 gebraucht, wo es um das „Bewachen“ einer Stadt geht. In Galater 3,23 wird das Wort mit „verwahren“ übersetzt, und 1. Petrus 1,5 spricht von „bewahren“. Wörtlich übersetzt könnte man sagen: „über jemand wachen“.
Der Friede Gottes bewacht uns also. Er bewahrt Herz und Sinn in Christus Jesus. Nicht wir bewahren den Frieden Gottes in unseren Herzen, sondern Gott bewahrt unsere Herzen in Frieden. Das ist ein beachtenswerter Unterschied. Es findet sozusagen ein „Tausch“ statt. Während wir unsere Sorgen bei Gott abladen, füllt und bewahrt Er Herz und Sinn im Gegenzug mit seinem Frieden. Das Herz ist der Sitz der Gedanken und Empfindungen. Es ist das Innerste des Menschen. Paulus erwähnt in 1. Korinther 14,25 das „Verborgene des Herzens“. Unsere Herzen werden nur zu leicht durch Umstände erschüttert (Joh 14,1). Der Sinn hat es mit dem Denken und dem Verstand zu tun. Beides ist miteinander verbunden, und beides muss bewahrt werden.
In Christus Jesus zeigt die Grundlage, auf der Gott Herz und Sinn in seinem Frieden bewahrt. Es ist Christus Jesus, der Sieger vom Kreuz, der verherrlichte Mensch im Himmel, der einst als demütiger Mensch auf der Erde war und selbst in schwierigsten Umständen gelebt hat. Den Frieden Gottes, von dem Gott selbst Quelle und Ursprung ist, können wir nur in der Gemeinschaft mit dem verherrlichten Christus genießen. Deshalb schreibt Paulus hier nicht von etwas, das wir „im Herrn“ haben, sondern davon, was wir in Christus Jesus haben.
Vers 8: Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt.
Zum Nachdenken
Im Übrigen leitet einen neuen und wichtigen Gedanken ein, der dennoch eng mit dem vorherigen verbunden ist. Es geht jetzt um die Frage, mit welchen Gedanken wir uns beschäftigen. Paulus fordert die Philipper auf, an positive Dinge zu denken. Nur ein Herz, das frei von Sorgen und Unruhe ist, wird in der Lage sein, sich wirklich mit dem zu beschäftigen, was Gott gefällt. Der Friede Gottes bewahrt uns vor diesem Geist der Sorge und Unruhe und schafft somit die Voraussetzung, der Aufforderung dieses Verses nachzukommen.
Unsere Gedanken sind Ausgangspunkt für unsere Worte und unsere Handlungen. Salomo hatte Folgendes erkannt: „Denn wie einer, der es abmisst in seiner Seele, so ist er“ (Spr 23,7). Ein Sprichwort sagt: „Bewahre deine Gedanken! Sie sind der Anfang deiner Taten!“ Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle halten und steuern. Paulus fordert die Korinther auf, jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen zu nehmen (2. Kor 10,5). Je mehr wir unsere Gedanken durch den Geist Gottes kontrollieren lassen, umso mehr werden wir mit den „Qualitäten“ beschäftigt sein, die wir vollkommen in Christus finden.
Paulus spricht hier keineWarnung aus, sondern eine Motivation. Er drückt es nicht negativ aus und sagt, was wir nicht tun sollen. Er drückt es positiv aus und zeigt, was wir sehr wohl tun sollen. J.N. Darby schreibt dazu: „Wir können mit dem Bösen beschäftigt sein, um es zu verurteilen und darin recht tun, aber das ist nicht Gemeinschaft mit Gott in dem, was gut ist. Wenn wir aber durch seine Gnade beschäftigt sind mit dem Guten, mit dem, was von Ihm kommt, so ist Er, der Gott des Friedens, mit uns.“5
Erwägen bedeutet nicht, dass wir flüchtig an etwas denken und es dann schnell wieder vergessen. Erwägen setzt gründliches Nachdenken und die Auseinandersetzung mit einer Sache voraus, auf die man seine Gedanken konzentriert richtet. Die Zeit, in der wir leben, ist mit einer großen Informationsflut verbunden. Viele Dinge nehmen wir zwar noch zur Kenntnis, können allerdings nicht mehr wirklich darüber nachdenken. Die Gefahr, diese Verhaltensweise auf geistliche Dinge zu übertragen, ist nicht gering.
- Alles, was wahr ist: Wahrheit steht zunächst dem gegenüber, was „falsch“ ist. Das Wort meint auch „echt“ oder „ursprünglich“. In dieser Welt finden wir keine Wahrheit, keine Zuverlässigkeit und keine Echtheit. Im Gegenteil. Sie ist von Lüge, Intrige und Imitation gekennzeichnet. Die christliche (religiöse) Welt ist davon nicht ausgenommen. In Kapitel 3 hatte Paulus vor falschen Lehren gewarnt. Es ist denkbar, dass er hier darauf anspielt. Wir können es jedoch ebenso weiter fassen. Unsere Gedanken sollen generell mit dem beschäftigt sein, was wahr und echt ist. Pilatus fragte einst lapidar: „Was ist Wahrheit?“ (Joh 18,38). Ein wirkliches Interesse hatte er nicht daran. Wir kennen die Antwort: Wirkliche Wahrheit ist nur in dem, was von Gott kommt und in der Person unseres Herrn zu finden ist. Er war gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. In seinem Leben erkennen wir, was Wahrheit ist. Jesus ist „die Wahrheit“ (Joh 14,6). Sein Wort ist „Wahrheit“ (Joh 17,17). Der Heilige Geist ist der „Geist der Wahrheit“ (Joh 15,26; 16,13). Deshalb lautet die Herausforderung, dass wir unsere Gedanken jeden Tag mit seinem Wort und seiner Person füllen.
- Alles, was würdig ist: Hier geht es um Dinge, die „angemessen“, „passend“ oder „respektabel“ sind. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die nicht zu uns als Christen passen, die uns dennoch immer wieder beschäftigen. Diese Dinge sollen wir beiseitelassen und uns stattdessen auf das konzentrieren, was zu uns passt. Wir sind Himmelsbürger, d. h. auf dem Weg zum Ziel. Wenn wir darauf bedacht sind, wird das unser tägliches Leben prägen. „Der Edle entwirft Edles, und auf Edlem besteht er“ (Jes 32,8). Das wird das Ergebnis sein, wenn wir mit würdigen Dingen beschäftigt sind. Bei dem Herrn Jesus war es immer so. Alles, was Er tat, entsprach zu jeder Zeit voll und ganz der Würde seiner Person. Er ist der Einzige, der wirklich ehrwürdig ist.
- Alles, was gerecht ist: Wirkliche Gerechtigkeit ist nur bei Gott zu finden. Er ist gerecht. Praktische und gelebte Gerechtigkeit – nach der wir streben sollen – ist die Übereinstimmung des Christen mit dem Wesen und offenbarten Willen Gottes. Es soll unser tägliches Bestreben sein, diese Übereinstimmung in unserem Leben zu suchen, darüber nachzudenken und danach zu streben. Wir sind in Christus gerechtfertigt. Das ist unsere Stellung (Röm 5,1). Dieser Stellung sollen wir im täglichen Leben entsprechen und gerecht leben. Vollkommen finden wir diese Gerechtigkeit im Leben des Herrn Jesus auf der Erde vorgestellt und ausgelebt. In Ihm haben sich Gerechtigkeit und Frieden „geküsst“ (Ps 85,11). Ohne diese praktische Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Von Ihm konnte gesagt werden: „Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst“ (Ps 45,8).
- Alles, was rein ist: Reinheit ist „Keuschheit“ (Tit 2,5; 1. Pet 3,2). Es geht darum, dass etwas frei von Korruption und Verderbnis ist. Das Wort hat die gleiche Wurzel wie das Wort „heilig“. Gott möchte, dass wir in Gedanken, Worten und Taten rein sind. In der Bergpredigt nennt der Herr diejenigen glückselig,„die reinen Herzens sind“. Da fängt praktische Reinheit an. In dieser Welt finden wir das nicht. Sie ist befleckt. Das Leben des Herrn Jesus hingegen war von göttlicher Reinheit und Sittlichkeit gekennzeichnet. Diese gleiche Reinheit soll jetzt unser Leben kennzeichnen. Wir sollen danach streben, ein Leben zu führen, in dem Gott gesehen und verherrlicht wird. Wie das geht, sagt uns der Psalmdichter: „Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort“ (Ps 119,9). Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes bringt diese Reinheit in unserem Leben hervor. Die Dinge dieser Welt werden uns nur beschmutzen.
- Alles, was lieblich ist: Lieblich bedeutet „teuer“, „angenehm“, „erfreulich“. Erneut werden unsere Gedanken zu dem Herrn Jesus geführt. Er allein ist schöner als die Menschensöhne (Ps 45,3). Die Braut in Hohelied sagt: „Lieblich an Duft sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name“ (Hld 1,3) und: „... alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter“ (Hld 5,16). Wenn wir das Leben des Herrn Jesus als Mensch auf der Erde anschauen, dann lernen wir etwas von dieser Lieblichkeit kennen, die von seinem Namen ausgeht. Gleichzeitig schätzen wir ebenso das, was von seiner Lieblichkeit in unseren Geschwistern sichtbar wird und erwägen es vor dem Herrn.
- Alles, was wohllautet: Es geht um das, was einen „guten Klang“ oder einen „guten Ruf“ hat, man könnte auch sagen, was „günstig“ und „ansprechend“ klingt. Als der Herr Jesus auf der Erde war, ging die „Kunde über ihn aus durch die ganze Gegend“, und die Menschen verwunderten sich über „die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen“ (Lk 4,14.22). Von Mordokai, der ein schönes Vorbild vom Herrn Jesus ist, lesen wir, dass er groß war im Haus des Königs, und dass sein Ruf durch alle Landschaften ging (Est 9,4). Der Herr Jesus hat einmal gesagt: „Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse bringt aus dem bösen das Böse hervor; denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund“ (Lk 6,45). Der Apostel Paulus fordert uns auf, dass unsere Worte „allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt“ sein sollen (Kol 4,6). Das wird das Ergebnis sein, wenn wir das erwägen, was wohllautet.
- Irgendeine Tugend: Die Tugend spricht im Neuen Testament von geistlicher Energie, von Entschiedenheit, Mannhaftigkeit und Tüchtigkeit. Der Gedanke an Selbstbeherrschung liegt ebenfalls in dem Wort. Das alles finden wir wiederum vollkommen im Leben des Herrn Jesus. Er ging seinen Weg in der Kraft des Geistes und war fest auf das Ziel hin orientiert. Am Ende hatte Er sein Angesicht festgestellt, nach Jerusalem zu gehen (Lk 9,51.53). Wir werden ebenfalls dazu aufgefordert, allen Fleiß anzuwenden, um in unserem Glauben die Tugend darzureichen (vgl. 2. Pet 1,5). Um das tun zu können, müssen unsere Herzen auf den Herrn Jesus gerichtet sein. Sind wir auf das fixiert, was die Welt uns geben kann, wird sich diese geistliche Energie, diese Entschiedenheit nicht entfalten können.
- Irgendein Lob: Lob steht für das, was vor dem Herrn empfehlenswert ist und anerkannt werden kann. Wenn unser Verhalten und unsere Worte Gott ehren, findet es die Anerkennung Gottes. Es geht nicht darum, dass wir – wie die Pharisäer – das suchen, was die Menschen loben, sondern das, was Gott gefällt. Erneut steht das Beispiel des Herrn Jesus vor uns. Er hat nichts von dem vergessen, was man Ihm aus Liebe getan hat (vgl. z. B. Mk 14,9), und Er hat öffentlich davon gesprochen. Wie oft sind wir – ganz anders als unser Herr – mit dem beschäftigt, was negativ ist. Wir erwägen und erwähnen die Fehler und Schwächen unserer Geschwister, anstatt auf das bedacht zu sein, was positiv und lobenswert ist. Der Apostel Paulus war nie „blind“ gegenüber den Gefahren und Schwächen der Gläubigen, gleichzeitig war er jedoch darauf bedacht, das zu loben, was lobenswert war. Ein Beispiel ist Titus: „Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen verbreitet ist“ (2. Kor 8,18).
Vers 9: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
Das Beispiel von Paulus
Paulus hatte die Philipper unterwiesen, als er bei ihnen war. Sie konnten ihn beobachten und hatten ihn kennengelernt. Sie hatten gelernt, empfangen, gehört und gesehen. Diese vier Aussagen umfassen auf der einen Seite Unterweisung in Lehre und Praxis und auf der anderen Seite das Beispiel in Wort und Tat. Diese beiden Seiten gehören immer zusammen. Lehre und Praxis können nie voneinander getrennt werden. Paulus hatte die Gläubigen unterwiesen und dann gleichzeitig deutlich gemacht, wie man das Gelernte in die Praxis umsetzt. Die Reihenfolge ist dabei wichtig. Zuerst müssen wir unterwiesen werden, danach kommt die praktische Verwirklichung.
Der Grundsatz gilt bis heute für jeden, der andere unterweist und belehrt. Die Pharisäer dienen als Warnung. Sie unterwiesen nur und gaben kein gutes Beispiel. Der Herr sagt: „Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet; aber tut nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht“ (Mt 23,3).
Was hatten die Philipper nun von Paulus gehört und gelernt? Er hatte ihnen Christus verkündigt. Was hatten sie an Paulus gesehen? Wie er Christus folgte. Was hatten die Kolosser von Paulus empfangen? Niemand anders als Christus (vgl. Kol 2,6). Paulus wies in allem auf Christus hin.
Das Wort, das Paulus für lernen gebraucht, ist vom gleichen Wortstamm abgeleitet wie das Wort, das für „Jünger“ benutzt wird. Ein Jünger ist zuerst jemand, der wie ein Schüler von einem anderen lernt. Dann ist er ein Nachfolger. Der beste „Lehrmeister“, den es je gegeben hat, ist der Herr Jesus selbst. Er sagt: „Lernt von mir“ (Mt 11,29). Diese Gelegenheit hatten die Philipper indirekt, wenn sie von Paulus lernten, denn Paulus folgte in den Fußspuren seines Meisters, wenn er andere belehrte. In Epheser 4,20 schreibt er davon, dass man Christus „lernen“ kann. Christus muss immer der Mittelpunkt christlicher Lehre und Unterweisung sein.
Empfangen bedeutet „nehmen“, „ergreifen“ oder etwas von einer Person „bekommen“. Das Wort wird z. B. benutzt, um zu zeigen, dass Paulus eine Offenbarung vom Herrn empfangen hatte (1. Kor 11,23). Paulus hatte das, was er von dem Herrn bekommen hatte, treu verwaltet und an die Gläubigen weitergegeben. Sie sollten es nun für sich zum persönlichen Besitz machen.
Hören und sehen ist die akustische und visuelle Wahrnehmung des Menschen. Man hört etwas und man sieht etwas. Genau das war bei den Philippern geschehen. Sie hatten gehört, was Paulus gelehrt hatte und sein Verhalten gesehen. Nun lag es an ihnen, dies in die Praxis umzusetzen. Paulus fordert sie auf: „Dies tut“. Das Verb steht in der Befehlsform. Nach dem „Erwägen“ in Vers 8 nun also das Tun. Wir sahen schon die enge Verbindung zwischen den Gedanken und dem Handeln. Die positiven Überlegungen des Herzens sollen in die Tat umgesetzt werden. In Richter 5,15 lesen wir von Leuten aus dem Stamm Ruben, bei denen „große Beschlüsse des Herzens“ waren. Was fehlte, waren die Taten. Im Gegensatz dazu hat Daniel seinen Herzensentschluss, sich in Babel nicht zu verunreinigen, in die Praxis umgesetzt. Er tat das, was er sich vorgenommen hatte.
Der Gott des Friedens
In Vers 7 hatte Paulus daran erinnert, dass der „Friede Gottes“ das Ergebnis eines abhängigen und vertrauensvollen Gebets ist. Hier nun sind die Gegenwart und die Hilfe des Gottes des Friedens die Folge, wenn wir den Willen Gottes tun.
Den Gott des Friedens mit sich zu haben geht noch etwas weiter, als den „Frieden Gottes“ zu genießen, obwohl beides großartig ist. Der „Friede Gottes“ gibt uns Ruhe in den Umständen, selbst wenn unsere Bitten anders erhört werden, als wir es gedacht haben. Wenn wir hingegen an den Gott des Friedens denken, werden wir zu der Quelle selbst geführt, die jedes Bedürfnis nach seiner Weisheit stillt. Das gibt uns Kraft durchzuhalten. Ohne Gott gibt es keinen Frieden. Er ist der Ursprung des Friedens. Er ist derjenige, der allein Frieden geben kann. Im Alten Testament finden wir diesen Ausdruck „Gott des Friedens“ nicht. Erst auf dem Fundament des vollbrachten Werkes vom Kreuz hat Gott sich so offenbart. Paulus macht hier klar, dass der Gott des Friedens sozusagen selbst in unser Leben hineinkommt und dort seinen Platz einnimmt. Er wird mit uns sein, d. h., wir genießen die Gemeinschaft mit Ihm und können jederzeit mit seiner Hilfe rechnen.
Das Neue Testament spricht mehrfach von dem Gott des Friedens:
- „Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus“ (1. Thes 5,23).
- „Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes“ (Heb 13,20).
- „Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen! Amen“ (Röm 15,33).
- „Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!“ (Röm 16,20).
Vers 10: Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken; obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit.
Die Freude von Paulus
Erneut kommt Paulus auf die Freude zu sprechen. Er hatte sich im Herrn sehr gefreut. Das Wort aber weist nicht auf einen Gegensatz hin, sondern leitet ein Thema ein, das Paulus wichtig war und das er nicht auslassen wollte. Es geht um seine Freude über die Gabe der Philipper. Ein anderer Briefschreiber hätte dieses zentrale Anliegen des Briefs vielleicht an den Anfang gestellt. Paulus macht es unter der Leitung des Heiligen Geistes anders. Er erwähnt die Gabe zwar schon vorher, spricht jedoch erst jetzt ausführlich darüber. Es war ihm wichtig, sich zu bedanken, dennoch gab es Dinge, die er vorher sagen wollte.
Wenn Paulus über die Philipper nachdachte, tat er dies mit besonderer Freude. Es war nicht zuerst eine natürliche Freude, sondern eine Freude im Herrn. Er wusste, wer es war, der ein Werk im Herzen der Philipper getan hatte. Deshalb galt sein Dank zuerst Gott. Den Korinthern schreibt Paulus: „… indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott Danksagung bewirkt“ (2. Kor 9,11).
Die Formulierung endlich oder „irgendwann“ könnte darauf hinweisen, dass Paulus schon darauf gewartet hatte. Das Ende des Verses macht hingegen deutlich, dass darin kein Vorwurf liegt. Paulus war klar, dass es nicht am guten Willen gelegen hatte, sondern dass sie einfach keine Gelegenheit gehabt hatten. Woran es scheiterte, wissen wir nicht. Vielleicht lag es an der großen Armut oder daran, dass sich kein geeigneter Bote gefunden hatte. Der Transfer von Geld war ja zur Zeit des Neuen Testaments wesentlich komplizierter als heute.
Paulus stellt den Philippern das Zeugnis aus, dass sie an ihn gedacht hatten. Sie nahmen Anteil an dem Ergehen von Paulus, und zwar sowohl innerlich als äußerlich. Das schließt die Fürsorge der Philipper für den Apostel ein. Das mit gedenken übersetzte Wort haben wir an anderer Stelle in unserem Brief als „Gesinnung“ wiedergefunden. Es ist nicht nur ein inneres „Überlegen“, sondern es ist ein Denken in eine bestimmte Richtung und mit einem bestimmten Ziel; ein Denken, aus dem die Gesinnung sichtbar wird.
Die Philipper waren aufgelebt. Das Wort kann man auch mit „aufblühen“ oder „aufsprießen“ übersetzen. Es ist wie im Frühjahr, wenn nach einem langen Winter alles erneut wächst und gedeiht. So sah Paulus die Gabe, und so hatte er sich über die Philipper gefreut. Der weitere Verlauf des Textes macht klar, dass es Paulus nicht zuerst um die Gabe ging, sondern darum, dass die Philipper an ihn gedacht hatten. Das war für ihn ein wichtiges Zeichen. Ohne Zweifel konnte Paulus die Unterstützung gut gebrauchen, denn es kam nicht oft vor, dass er unterstützt wurde. Oft hatte er unterwegs selbst für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Hier im Gefängnis war er hingegen auf externe Hilfe angewiesen. Deshalb war seine Freude groß.
Vers 11: Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen.
Die Genügsamkeit von Paulus
Dieser Vers gibt einen tiefen Einblick in die Erfahrungen des Apostel Paulus bezüglich seines täglichen Bedarfs. Ohne Frage hatte er im Gefängnis in Rom täglich Mangel oder Einschränkung, wenn nicht gar Not. Er wollte indes nicht den Eindruck erwecken, dass er mehr haben wollte, als die Philipper ihm geschickt hatten. Paulus wollte nicht „betteln“. Er freute sich über die Gabe. Gleichzeitig sollten die Philipper wissen, dass er jeden Lebensumstand aus der Hand seines Herrn nahm. Er hatte gelernt, sich mit dem zu begnügen, was der Herr ihm jeden Tag zugedachte.
Paulus macht deutlich, dass er in den Fußspuren seines Meisters war, der sich als Mensch auf der Erde jeden Morgen das Ohr wecken ließ, um belehrt zu werden (Jes 50,4). Paulus hatte in seiner Nachfolge und Schule wichtige Dinge gelernt. Die Umstände seines Lebens (worin ich bin) waren nicht der bestimmende Faktor für sein Glück. Er hatte gelernt, sich zu begnügen. Paulus ist hier ein Beispiel für andere. Das Wort sich begnügen meint so viel wie „autark zu sein“. Paulus fühlte sich also unabhängig von seinen momentanen Umständen und denen, die ihm halfen, weil er alles von seinem Herrn annahm und wusste, dass Er ihn versorgen würde.
Der Satz macht klar, welch ein Verhältnis Paulus zum Geld und zu den Annehmlichkeiten des Lebens hatte. Er beweist, dass seine Worte an Timotheus für ihn keine Theorie waren: „Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn … Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen ... Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen“ (1. Tim 6,6-10). Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt diese beiden Dinge ebenfalls zusammen und schreibt: „Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt: ‚Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen‘“ (Heb 13,5). Es ist bemerkenswert, dass die Genügsamkeit an beiden Stellen mit einer Warnung vor der Geldliebe verbunden wird. Offenbar schließt das eine das andere aus.
Viele von uns leben heute in einer Zeit materieller Absicherung. Dennoch wollen wir uns trotz regelmäßigen Einkommens und den manchen Versicherungen fragen, wem letztlich unser Vertrauen gilt. Die Verheißungen Gottes sind immer aktuell. Letztlich ist Er es, der es übernimmt, für uns zu sorgen: „… sein Brot wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie“ (Jes 33,16).
Die Erfahrung dieses Verses zu vermitteln, ist ohne Frage eines der zentralen Anliegen des ganzen Briefs. Das konnte Paulus nicht einfach tun, indem er einen lehrmäßigen Grundsatz vorstellte, sondern er spricht aus Erfahrung, die aus der Gemeinschaft mit seinem Herrn gewachsen war. Er hatte es in der „Schule des Lebens“ in der Nachfolge seines Herrn gelernt oder erfahren. Das Geheimnis seiner Genügsamkeit lag in seiner engen Verbindung zu seinem Herrn und in seinem Vertrauen zu seinem Gott. Er nahm alles von Gott an.
Genügsamkeit ist eine schwierige Lektion für uns. Die Welt, in der wir leben, lehrt uns das Gegenteil. Judas beschreibt die Menschen unserer Tage so: „Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Begierden wandeln“ (Jud 16). Das Fleisch in uns will immer mehr haben. Die Werbung will Bedürfnisse wecken, die gar nicht vorhanden sind und doch befriedigt werden wollen. Wir wollen uns das Beispiel von Paulus deshalb zu Herzen nehmen und für das dankbar sein, was der Herr uns gibt, ohne ständig nach mehr zu streben. „Gott aber vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, allezeit alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk“ (2. Kor 9,8).
Vers 12: Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben; in jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden.
In allem unterwiesen
Paulus war nicht nur genügsam, sondern er war zufrieden mit seinen Umständen. Gott hatte ihn verschiedene Lebenssituationen erleben lassen und ihn dadurch unterwiesen. Paulus hatte im Überfluss und im Mangel gelernt. Er wusste, was Armut bedeutet und wusste, was es bedeutet, (mehr als) genug zu haben.
Wir fragen uns beim Lesen dieses Verses, wie Paulus für sich Überfluss definierte und wann er diese Zeiten erlebt hat. Sicher war seine Interpretation von Überfluss anders als die vieler Menschen. Überfluss bedeutete für ihn sicher nicht „Luxus“, sondern Zeiten, in denen er mehr gehabt hatte, als er in diesem Moment unbedingt zum Leben brauchte. In Offenbarung 19,21 wird das Wort mit „gesättigt“ übersetzt. Man könnte es sogar mit „mästen“ übersetzen. Davon war Paulus nach unseren Maßstäben bestimmt weit entfernt, wenn er hier von „Überfluss“ schreibt. Dennoch benutzt er gerade dieses Wort.
Gott hatte ihn Zeiten erleben lassen, in denen er mehr gehabt hatte als er unbedingt nötig hatte, und Paulus war dankbar dafür. Doch er wusste zugleich um schwierige Lebensbedingungen. Davon schreibt er den Korinthern: „Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung“ (1. Kor 4,11). Im zweiten Brief an die Korinther kommt er noch einmal darauf zurück: „Und als ich bei euch anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemand zur Last“ (2. Kor 11,9). Wie sehr folgte Paulus den Fußspuren des Herrn, der ebenfalls Hunger kannte (Mk 11,12) und oft nicht wusste, wo er sein Haupt zum Schlafen hinlegen sollte (Lk 9,58)!
Es fällt vielen von uns schwer, diese Erfahrung von Paulus nachzuvollziehen. Ältere Glaubensgeschwister mögen solche Zeiten noch erlebt haben, für viele Leser des Briefs ist echter Hunger und echte Entbehrung heute vermutlich eine weitgehend unbekannte Erfahrung. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die Worte Agurs: „Armut und Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir beschiedenen Brot; damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche: Wer ist der Herr?, und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes“ (Spr 30,8.9). Armut einerseits und Reichtum andererseits können eine Gefahr sein. Armut kann zur Unzufriedenheit und zum Murren führen. Reichtum birgt die große Gefahr, unabhängig zu leben. Bei Paulus war es so, dass ihn beides nicht zum Schlechten beeinflusste. Sein innerer Zustand wurde dadurch nicht anders. In jedem und allem war er unterwiesen, d. h., „in jeder Erfahrung und in allen Lebensumständen“ hatte er gelernt. J. N. Darby schreibt zu diesem Vers: „Wenn wir voll sind, bewahrt Er uns davor, sorglos, gleichgültig und selbstzufrieden zu sein. Wenn wir hungrig sind, bewahrt Er uns davor, niedergeschlagen und unzufrieden zu sein.“ 6
Vers 13: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.
Die Kraft des Paulus
Es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang beachten, in dem dieser Kernvers des Kapitels steht. Um das zu verwirklichen, was Paulus in den Versen 11 und 12 geschrieben hat, ist die Kraft von oben nötig. Seine Genügsamkeit war keine menschliche Zufriedenheit. Sie ist nicht das Ergebnis eigener Anstrengungen, sondern sie ist nur in der Kraft Gottes zu verwirklichen. Das ist zuerst gemeint, wenn Paulus sagt: Alles vermag ich. Wir können diesen Vers nicht „missbrauchen“ und ihn auf alle Wünsche und Vorhaben beziehen, die ein Gläubiger hat. Wenn etwas dem Willen Gottes entspricht, können wir sicher sein, dass wir es in seiner Kraft tun können. Wenn Gott einen Auftrag gibt, gibt er sowohl die Befähigung als auch die Kraft. Allerdings wollen wir beachten, dass Paulus hier eine persönliche Erfahrung wiedergibt. Er drückt die Aussage bewusst in der Ich-Form aus. Nur wer dies persönlich erfahren hat, kann so etwas von Herzen sagen.
Der mich kräftigt ist der Herr. Die Kraft gibt Er nicht ein für alle Mal, sondern Er tut es immer wieder. Wörtlich bedeutet der Ausdruck: „in dem mich Kräftigenden“. Aus der Gemeinschaft mit Ihm kam die Kraft. Als Paulus dies schrieb, war er etwa 4 Jahre in Haft und hatte jeden Tag in den schwierigen Umständen Kraft bekommen. In 2. Timotheus 4,17 schreibt Paulus erneut von dieser Kraft: „Der Herr stärkte mich“. Und in 2. Korinther 12,9 lesen wir die Worte Gottes: „Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht“. Paulus war weder mental noch physisch von seiner eigenen Kraft und Stärke abhängig, sondern wusste sich stark in seinem Herrn.
Vermögen ist hier ein geistliches Vermögen. Es bedeutet, dass Paulus die nötige Kraft hatte. Es nimmt Bezug direkt auf den Mangel, von dem Paulus geschrieben hatte, kann jedoch nicht darauf beschränkt bleiben. Wir können es anwenden auf jede Art von Leiden und Widerwärtigkeiten im Dienst für den Herrn.
Vers 14: Doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt.
Das Lob des Paulus
Paulus wollte nicht, dass die Philipper die Aussage von Vers 13 irgendwie missverstanden. Selbst wenn er alles in der Kraft dessen vermochte, der bei ihm war, hatte er die Gabe seiner Geschwister sehr geschätzt. Deshalb dieses erneute Lob für die Philipper. Sie hatten an seiner Drangsal teilgenommen, und das hatte Paulus gutgetan. Es war nicht nur eine „innere Teilnahme“ in Gedanken und Gebeten gewesen, sondern eine Teilnahme, die sich in Taten ausdrückte.
Teilnehmen bedeutet Gemeinschaft zu haben. Es schließt den Gedanken einer Partnerschaft ein. Durch die Gabe hatten die Philipper Anteil an seiner Gefangenschaft. Es ging keineswegs allein um die Gabe, sondern darum, dass sie die Not von Paulus als ihre eigene Not ansahen und daran teilnahmen. Sie verwirklichten das, was der Hebräerbrief sagt: „Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen …“ (Heb 10,34).
Paulus nennt seine Gefangenschaft hier eine Drangsal. Das Wort schließt den Gedanken an „Spannung“ und „Druck“ ein. So empfand Paulus seine Zeit in Rom, und deshalb freute er sich umso mehr über die Anteilnahme der Philipper.
Verse 15.16: Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt.
Die Anerkennung und Erinnerung des Paulus
Es mag sein, dass uns solche Details auf den ersten Blick unwichtig erscheinen. Dennoch hat Gott es für wichtig gehalten, uns diese Dinge zur Belehrung mitzuteilen. Es ist Gottes Gedanke, dass Diener im Werk des Herrn unterstützt werden. Er registriert jeden kleinen Betrag, der aus Liebe für Ihn und sein Werk gegeben wird. Natürlich sorgt der Herr im Himmel für seine Diener. Zugleich möchte Er dazu die Gläubigen benutzen. Diese Verantwortung legt Er auf jeden von uns.
Paulus tat das, was er kurz vorher geschrieben hatte. Er dachte an das, was lobenswert war und das war nicht nur die Gabe, die seine Geschwister ihm jetzt nach Rom geschickt hatten. Paulus erinnert sich dankbar an das zurück, was etwa 10 Jahre vorher geschehen war. Als Paulus zum ersten Mal in Philippi gewesen war (Apg 16), führte ihn sein weiterer Weg nach Thessalonich (beide Städte lagen in Mazedonien). Dort war er vielleicht lediglich 3 bis 4 Wochen gewesen, und in dieser kurzen Zeit hatten die Philipper ihn zweimal unterstützt. Paulus wusste, dass Gott nicht ungerecht sein würde, das Werk und die Liebe der Gläubigen zu vergessen (Heb 6,10), und so wollte er es nicht anders handhaben. Warum die Philipper Paulus danach anscheinend 10 Jahre lang nicht unterstützt hatten, wissen wir nicht. Die Bibel schweigt über die Gründe. Es ist denkbar, dass es ein Mangel an Gelegenheit war. Jedenfalls war Paulus in dankbarer Erinnerung im Blick auf die Philipper.
Gleichzeitig erkennt man zwischen den Zeilen etwas von der Trauer, die Paulus empfand, dass keine andere Versammlung dem Beispiel der Philipper gefolgt war. Nur sie hatte ihm mitgeteilt. Das Wort bedeutet, dass sie ihm etwas zum Gebrauch gegeben hatten. Paulus spricht von Geben und von Empfangen. Beides ist voneinander unterschieden. Zum Geben ist ebenso Gnade und Weisheit nötig wie zum Empfangen. Der Geber fragt sich vor dem Herrn, wem er etwas gibt, was er gibt und wann er es gibt. Der Empfänger fragt sich vor dem Herrn, ob er eine Gabe annimmt oder ob er sie nicht annimmt. Es ist bemerkenswert, dass Paulus keine Gabe von den Korinthern haben wollte, weil sie in einem geistlich schlechten Zustand waren. Selbst von den Thessalonichern hatte er nichts genommen, weil er die Gefahr sah, dass einige der Gläubigen dies falsch interpretieren könnten. Es gab einige, die unordentlich wandelten, indem sie ihren Geschwistern finanziell „auf der Tasche“ lagen. Für solche würde es vielleicht „Wasser auf die Mühlen“ gewesen sein, hätte Paulus sich unterstützen lassen. Er schreibt dazu: „Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Während wir Nacht und Tag arbeiteten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt“ (1. Thes 2,9). Darüber hinaus berichtet die Bibel von keiner anderen Versammlung, die Paulus finanziell unterstützt hat. Die Philipper nehmen in diesem Punkt eine besondere Stellung ein.
Durch die besondere Anrede ihr Philipper unterscheidet Paulus sie von anderen. Es ist ein Ausdruck besonderer Wertschätzung. Diese spezielle Anrede finden wir auch an anderen Stellen, allerdings nicht positiv belegt, sondern negativ: Den Korinthern schreibt er in 2. Korinther 6,11: „Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther; unser Herz ist weit geworden.“ In Galater 3,1 lesen wir: „O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?“.
Das Wort Versammlung kommt in diesem persönlich gehaltenen Brief nur zweimal vor. Es umfasst alle Gläubigen, die Gott aus dieser Welt herausgerufen hat. In Kapitel 3,6 hatte Paulus sich ein Verfolger der „Versammlung“ genannt. Offensichtlich denkt er da an die Versammlung in ihrem allgemeinen und globalen Sinn. In unserem Vers hat er die örtliche Versammlung vor Augen, von denen Philippi eine war. Es handelt sich um ein und dieselbe Versammlung, nur unter unterschiedlichem Blickwinkel. Wir wollen daran festhalten, dass die örtliche Versammlung nichts anderes als eine Darstellung (ein sichbtarer Ausdruck) der weltweiten Versammlung ist. Diese beiden Seiten der Versammlung voneinander zu trennen, führt zu falschen Gedanken über das, was Gott so wichtig ist. Er hat sich die Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes (Apg 20,28).
Vers 17: Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung.
Die Gesinnung des Paulus
Dieser Vers beugt einem weiteren möglichen Missverständnis vor und zeigt gleichzeitig erneut etwas von der Gesinnung des Paulus im Blick auf die Gläubigen. Paulus suchte nicht die Gabe der Philipper an sich, sondern die Frucht, die durch diese Gabe sichtbar wurde. Er wusste, dass Gott auf alleWeise für ihn sorgen konnte. Er war innerlich weit davon entfernt, die Gottseligkeit zu einem Mittel zum Gewinn zu machen (1. Tim 6,5). Paulus dachte nicht zuerst an sich, sondern an die Philipper. Darin offenbarte er erneut die Gesinnung seines Herrn. Paulus kannte keine Habsucht. Er wollte nichts für sich. Er bat nicht um eine weitere Gabe. Was er suchte, war die Frucht für die Rechnung der Philipper.
Frucht ist hier nicht so sehr das auf der Erde sichtbare Ergebnis einer Bemühung, sondern nimmt Bezug auf die Belohnung, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird (vgl. Kap. 1,11.22). Die Gabe der Philipper war für sie eine Möglichkeit, sich Schätze im Himmel zu sammeln (Mt 6,20). Darin würden sie reich in Bezug auf Gott sein. Das Gegenteil beschreibt der Herr in Lukas 12,21: „So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott.“ Es ist eine geistliche und ewige Frucht für eine materielle und zeitliche Unterstützung. Salomo wusste schon: „Wer sich des Geringen erbarmt, leiht dem Herrn; und er wird ihm seine Wohltat vergelten“ (Spr 19,17).
Das Wort Rechnung wird sonst häufig mit „Wort“ (logos) übersetzt. Es bedeutet aber auch „Rechenschaft“ oder in der Kaufmannssprache eben Rechnung. Was sie taten, wurde zu ihren Gunsten angerechnet. Es war wie ein „Zins“, den sie als Lohn bekommen würden.
Die Frucht sollte nicht spärlich sein, sondern überströmend. In 2. Korinther 4,15 lesen wir von der überreichen Gnade, die eine „überströmende“ Danksagung bewirkt. In 1. Thessalonicher 3,12 wünscht Paulus, dass die Gläubigen „überströmend“ in der Liebe zueinander sind. Hier ist es die „überströmende“ Frucht. Dabei kam es nicht auf die Größe der Gabe an. Sie war nicht entscheidend, sondern es geht um die Frucht. Die Hingabe, die hinter der Gabe steckte, wird von Gott vergolten werden. Der eine Cent, den die arme Witwe gab, hatte für Gott mehr Wert, als die großen Summen, die andere in den Schatzkasten eingelegt hatten (Mk 12,41-44).
Vers 18: Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss; ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.
Die Zufriedenheit des Paulus
Paulus war in der Tat zufrieden. Trotz äußerer Not, trotz des Mangels im Gefängnis, konnte er von Überfluss sprechen. Alles bedeutet nicht, dass es gar nichts gegeben hätte, was ihm fehlte, sondern es meint alles „Notwendige“. Darüber hinaus liegt der Gedanke darin, dass die Philipper ihn „voll ausgezahlt“ hatten. Er will mit dieser Formulierung sagen, dass sie ihm nichts schuldig waren. Das Wort wurde z. B. in Verbindung mit einer Quittung gebraucht, die belegt, dass alles bezahlt und geregelt ist.
Überfluss will sagen, dass Paulus von der Gabe der Philipper erfüllt ist. Man hat den Eindruck, dass Paulus in diesen Versen gar nicht zu Ende kommt, zu beschreiben, wie viel ihm die Liebe und Fürsorge der Philipper bedeutete, die in der Gabe sichtbar wurde. Wir sollten das für uns als Anregung aufnehmen, wie die Philipper an Geschwister zu denken, die in Not sind. Das muss nicht immer eine finanzielle Hilfe sein, sondern es gibt andere Möglichkeiten, unser Mitempfinden und unsere Gemeinschaft der Liebe zu zeigen.
Der Wert der Gabe
Nun beschreibt Paulus den wahren Charakter der Gabe. Er tut das mit sehr tiefgehenden Worten. Die Gabe war:
- ein duftender Wohlgeruch: Der Ausdruck nimmt Bezug auf den Opferdienst im Alten Testament. Wiederholt lesen wir bei den freiwilligen Opfern (Brandopfer und Friedensopfer), dass sie ein „lieblicher Geruch“ für Gott waren. Das Leben, das Opfer und die darin erkennbare Hingabe des Herrn Jesus an seinen Gott waren zu seiner Freude und zu seinem Wohlgefallen. Die Formulierung duftender Wohlgeruch findet sich nur noch einmal im Neuen Testament. In Epheser 5,2 wird so das Opfer des Herrn Jesus beschrieben. Es war „Gott zu einem duftenden Wohlgeruch“. Es ist bemerkenswert, auf welch ein Niveau Paulus die Gabe der Philipper hebt. Wir lernen, dass alles, was aus einem Herzen der Liebe für Gott hervorkommt und getan wird, ein duftender Wohlgeruch für Ihn ist.
- ein angenehmes Opfer: Das Wort Opfer wird im Neuen Testament sowohl für geistliche Schlachtopfer (1. Pet 2,5) als auch für das Opfer und die Hingabe im Leben des Gläubigen (Röm 12,1) benutzt. Das führt uns zu Hebräer 13,15.16, wo beides miteinander verbunden wird: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.“ Es ist für Gott eine Freude, wenn wir Ihn persönlich oder gemeinsam als Volk Gottes loben und preisen. Wenn wir mit dem Opfer des Herrn Jesus beschäftigt sind, kann es nicht anders sein. Wir danken Gott für die Gabe seines Sohnes und bringen Ihm Anbetung. Gott sucht diese Frucht der Lippen bei uns. Die zweite Seite folgt jedoch unmittelbar und ist nicht weniger wichtig. Gott wartet ebenso auf die materiellen Opfer, d. h. darauf, dass wir das, was Er uns anvertraut hat, für Ihn einsetzen. Das betrifft einerseits unser ganzes Leben und unseren Leib (Röm 12,1), andererseits das, was Gott uns in die Hand gegeben hat. Das „Mitteilen“ hat es mit Gemeinschaft zu tun. Genau das hatten die Philipper getan. In ihrer Gabe wurde ihre Gemeinschaft mit dem gefangenen Apostel sichtbar. Gott wartet in unserem Leben auf beides. Das eine geht nicht ohne das andere.
- Gott wohlgefällig: Gott fand Gefallen an dem Opfer der Philipper. In Römer 12,1 geht es um das Opfer des Lebens, das Gott wohlgefällig sein soll. In Römer 14,18 geht es um den Dienst, der Gott wohlgefällig sein soll. In 2. Korinther 5,9 geht es um das gesamte Leben, das Gott wohlgefällig sein soll. Gott möchte an unserem ganzen Verhalten Gefallen finden. Im Leben des Herrn Jesus war das vollkommen der Fall.
Vers 19: Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
Die Zuversicht des Paulus
Dieser Vers drückt keine theoretische Wahrheit aus, sondern eine tiefe Zuversicht, die nur aus der persönlichen Erfahrung von Paulus kommen konnte. Deshalb sagt er hier mein Gott. Der Ausdruck kommt im Alten Testament häufig vor (besonders in den Psalmen). Im Neuen Testament wird er sehr selten gebraucht. In größter Not am Kreuz hat der Herr Jesus seinen Gott so angeredet. Thomas nennt den Herrn einmal so (Joh 20,28), und Paulus selbst gebraucht den Ausdruck außer in unserem Vers nur noch einmal in 2. Korinther 12,21.
Die Anrede zeugt von der tiefen persönlichen Beziehung, die Paulus zu seinem Gott hatte. Er hatte Ihn als einen sehr „großzügigen“ Gott kennengelernt. Er wusste „aus Erfahrung“, dass Gott ein Gott ist, der sich um die Bedürfnisse seiner Kinder kümmert und immer reichlich gibt.
Die Aussage mag auf den ersten Blick wie ein Wunsch klingen. Es ist aber kein Wunsch, sondern eine Tatsache. Paulus kannte seinen Gott und wusste aus Erfahrung, dass Er genau das tun würde. Durch die Gabe der Philipper an Paulus konnte bei ihnen ein Mangel entstanden sein. Sie hatten nämlich nicht von ihrem Überfluss gegeben, sondern ihre Gabe war ein echtes Opfer. Die Not von Paulus lag ihnen am Herzen. Gott hatte das gesehen, und Paulus war sich sicher, dass dieser nun bei den Philippern entstandene Mangel von Gott gestillt werden würde. Außerdem hatten die Philipper mehr als materielle Hilfe nötig. Paulus konnte von Rom aus für sie beten. Er konnte sich bei ihnen bedanken. Alles Weitere konnte er beruhigt seinem Gott überlassen. Er konnte nicht das tun, was er sicher von Herzen gern getan hätte. Doch was er nicht tun konnte, das würde Gott in weitaus größerem Maß tun. Das gilt bis heute. Manchmal sind uns die Hände gebunden, um das für unsere Geschwister zu tun, was wir gern tun würden. Dann gilt unser Vertrauen Gott. Er tut unendlich viel mehr, als wir je tun könnten.
Gott ist ein Gott, der „reichlich darreicht“ (1. Tim 6,17). Wenn das schon für die natürlichen Bedürfnisse gilt, wie viel mehr für die geistlichen Bedürfnisse. Gott gibt alles Nötige – nicht nur das, was wir an materieller Versorgung brauchen. Mehr noch: Gott gibt nicht nach dem Maß unserer Bedürfnisse, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben hat, wird uns mit ihm alles schenken (Röm 8,32).
Die Liebe Gottes gibt das, was für uns gut und richtig ist. Gott gibt uns nicht das, was unsere fleischlichen Begierden wollen oder was vielleicht unseren törichten Bitten entspricht. Nein, Gott gibt das, was unseren realen Bedürfnissen entspricht. Der Garant dieser Sicherheit ist der Herr Jesus. In Ihm erfüllen sich alle Zusagen Gottes (2. Kor 1,20). Wenn der Reichtum Gottes uns in Herrlichkeit begegnet, ist es immer in Christus Jesus. Nur in Ihm wird alle göttliche Herrlichkeit sichtbar, denn nur in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig (Kol 2,9).
Gott gibt nicht einfach „aus“ seinem Reichtum, sondern Er gibt nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Gott gibt nicht nur etwas von dem, was Er hat, sondern Er öffnet uns sein ganzes Herz. Er tut das seinem Reichtum entsprechend. Deshalb gibt Gott nie wenig, sondern immer viel. Und Er tut es auf eine herrliche Art und Weise, wodurch seine Liebe in Fürsorge zu uns sichtbar wird. Hinzu kommt, dass der Reichtum Gottes in keiner Weise weniger wird, wenn Er uns gibt. Deshalb gibt Er nicht von seinem Reichtum, sondern nach seinem Reichtum. Der Maßstab seines Gebens entspricht seinem Reichtum.
Vers 20: Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Der Lobpreis des Paulus
InVers 19 hatte Paulus von seiner Erfahrung und von seinem Gott gesprochen. Jetzt bricht er in einen Lobpreis (eine Doxologie) aus und schließt die Briefempfänger mit ein. Deshalb sagt er unserem Gott und Vater. In dem Herrn Jesus ist der große Gott „unser Gott und Vater“ geworden. Das ist die Offenbarung des Herrn Jesus am Auferstehungsmorgen an Maria: „Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17). Wir haben eine persönliche Beziehung zu Ihm, die einschließt, dass wir Ihn loben und preisen.
Gott die Herrlichkeit zu geben schließt ein, dass wir Ihn in seiner Natur, seinem Charakter und seinem wunderbaren Handeln anerkennen. Wer einmal gesehen hat, wie herrlich Gott ist und wie herrlich Er handelt, wird von Herzen in einen solchen Lobpreis einstimmen. Dieser Lobpreis ist „von Ewigkeit zu Ewigkeit“, d. h. immerwährend und ohne Ende. Es wird uns ewig beschäftigen und erfreuen, Ihm die Herrlichkeit zu geben.
Das Amen gleicht einem Siegel. Es ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck. In Offenbarung 3,14 ist es ein Titel des Herrn Jesus. Er ist „der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge“. Wenn wir es z. B. am Ende eines Gebets gebrauchen, ist die Bedeutung „wahrlich“ oder „so sei es“. Es ist eine Bestätigung dessen, was man im Gebet vor Gott gebracht hat. Wenn Gott ein „Amen“ ausspricht, ist die Bedeutung „so ist es“, und „so wird es sein“. Wenn Gott etwas sagt, besteht kein Zweifel daran, dass es eintritt.
Das Ende dieses Briefs beginnt mit diesem Lobpreis. Alles, was die Philipper für Paulus getan hatten, sollte zur Ehre Gottes sein und war es auch. Bei der Betrachtung eines solchen Briefs sollten unsere Herzen ebenfalls überfließen. Dazu haben wir allen Grund. Alle Ehre und Herrlichkeit gehören unserem Gott und Vater – sowohl jetzt als in Ewigkeit.
Verse 21.22: Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers.
Die Grüße des Paulus
Die Grüße am Ende der Briefe sollten wir, ebenso wie die Einleitungsverse, nicht einfach überlesen. Sie sind wichtig. Wie in Kapitel 1,1, nennt er die Gläubigen Heilige in Christus Jesus. Das ist unsere persönliche Stellung vor Gott. Gleichzeitig deutet dieses verbindende Element die Einheit der Gläubigen an. In unserer Stellung als Heilige gibt es keinen Unterschied. Unabhängig vom Alter, von der Erfahrung, dem geistlichen Verständnis usw. sind wir Heilige. Das sind wir nicht in uns selbst, sondern in Christus Jesus. Jeder ist um den gleichen Preis ein „Heiliger“ geworden.
Paulus legt Wert darauf, dass jeder gegrüßt werden soll. Das betont den persönlichen Aspekt. Paulus will in der Liebe zu diesen Heiligen keinen Unterschied machen. Keiner soll vergessen werden. Keiner ist unwichtig.
Nun richtet Paulus Grüße von denen aus, die bei ihm waren. Wer diese Brüder waren, wissen wir nicht. Alle Heiligen nimmt wohl Bezug auf die Geschwister in Rom. Aufschlussreich ist der Hinweis auf die aus dem Haus des Kaisers. Wer genau damit gemeint ist, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Offensichtlich waren durch das Zeugnis von Paulus Menschen im weiteren Umfeld des Kaisers zum Glauben gekommen. Wir können z. B. an Soldaten der Leibwache denken oder an diejenigen, die ständig bei Paulus waren. Sie mögen manches von den Unterredungen und Gebeten ihres Gefangenen mitbekommen haben. Für Paulus muss es eine große Ermunterung gewesen sein. Jedenfalls illustriert es den Hinweis über die Eidechsen in Sprüche 30,28: „Die Eidechse kannst du mit Händen fangen, und doch ist sie in den Palästen der Könige.“ Das Wort Gottes findet über seine Diener sogar Zugang in die Regierungszentralen dieser Welt. Den Evangelisten mag man binden. Das Evangelium kennt keine Grenzen.
Vers 23: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist! Amen.
Der Segenswunsch des Paulus
Paulus hat in diesem Brief verschiedene „Wünsche“ an die Philipper geäußert. Jetzt kommt sein letzter. Es ist nicht einfach eine notwendige „Schlussformel“, sondern eine ganz bewusste Bitte. Sie richtet sich weniger an die Philipper als vielmehr direkt an seinen Herrn.
Die Philipper damals hatten – wie wir heute – die Gnade des Herrn Jesus Christus nötig. Gnade ist unverdiente Zuwendung Gottes. Es ist Gnade, die uns gerettet hat (Eph 2,5). Es ist Gnade, die uns bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird (1. Pet 1,13). Es ist ebenfalls Gnade, die uns im Leben durch diese Wüste das gibt, was wir nötig haben. Paulus hatte den Brief mit der Gnade begonnen (Kap. 1,2), und nun schließt er mit der Gnade.
Wie in Galater 6,18 und 2. Timotheus 4,22 wird die Gnade hier mit dem Geist des Menschen verbunden. Durch den Geist sind wir fähig, mit Gott in Verbindung zu treten. Der Geist unterscheidet uns Menschen von allen anderen Geschöpfen. Gott möchte mit uns persönlich Gemeinschaft haben. Dazu brauchen wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus.
Paulus nennt seinen Herrn hier am Ende noch einmal mit seinem vollen Titel Herr Jesus Christus. In Kapitel 3,21 ist dieser Titel mit Herrlichkeit verbunden. Hier – wie am Anfang des Briefs – wird er mit Gnade in Verbindung gebracht. Als Er zum ersten Mal auf die Erde kam, brachte Er die Gnade, und jetzt trägt Er uns in seiner Gnade. Wenn Er noch einmal kommt, wird der Charakter Herrlichkeit sein, und wir sind gewürdigt, diese Herrlichkeit in seinem Reich mit Ihm zu teilen.
Der Brief schließt – wie andere Briefe ebenfalls – mit einem Amen. Von Herzen gern stimmen wir in diese Schlussbestätigung ein.
Fußnoten


 Download als PDF (DIN A4) (kaufen)
Download als PDF (DIN A4) (kaufen) Download als EPUB (kaufen)
Download als EPUB (kaufen) Download als MOBI (kaufen)
Download als MOBI (kaufen) Modul für theWord (kaufen)
Modul für theWord (kaufen)