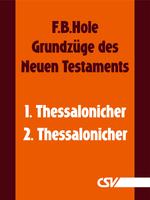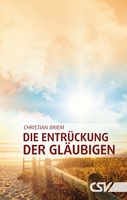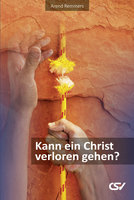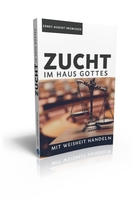Einführung in die beiden Briefe an die Thessalonicher
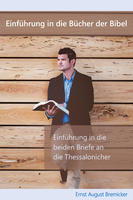
Die beiden Briefe an die Thessalonicher sind inhaltlich miteinander verbunden. Paulus schrieb sie in einem relativ kurzen Zeitabschnitt an dieselbe Versammlung. Die Thessalonicher waren noch nicht lange auf dem Weg in der Nachfolge hinter ihrem Herrn her. Dennoch dienten sie Ihm in großer Hingabe und erwarteten seine Rückkehr täglich. Aufgrund fehlender Belehrung gab es jedoch Fragen, zu denen Paulus ihnen in seinen beiden Briefen Hilfestellung gibt. Beide Briefe sind wichtig und notwendig für uns. Zum einen lernen wir die wichtige Wahrheit über das Kommen unseres Herrn. Zum anderen erhalten wir praktische Hilfestellung für aktuelle Lebensfragen.
1. Zwei Briefe – ein Thema
Das große Thema der beiden Briefe von Paulus an die Thessalonicher ist die Wiederkunft des Herrn Jesus – und zwar sowohl um die Seinen zu entrücken, als auch sein öffentliches Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Beide Briefe richten sich an Gläubige einer örtlichen Versammlung (Gemeinde), die noch sehr jung im Glauben waren, allerdings in der überzeugten täglichen Erwartung auf das Kommen ihres Herrn lebten. Besonders der erste Brief atmet geradezu die Frische des Glaubenslebens dieser jungen Christen. Es mangelte ihnen zwar noch an Erkenntnis, dafür bewiesen sie jedoch in ihrem Leben gerade das, was der Herr Jesus später bei den Gläubigen in Ephesus vermisste. Die Epheser waren mit den höchsten christlichen Wahrheiten bekannt, über die Paulus in seinem Brief an diese Versammlung schreibt. Dennoch hatten sie wenig später ihre erste Liebe verlassen (vgl. Off 2,4). Bei den Thessalonichern war das anders. Obwohl Paulus nur relativ kurze Zeit bei ihnen gewesen war, hatten sie das Wort nicht nur mit Freuden aufgenommen, sondern setzten es im täglichen Leben in die Praxis um. Paulus stellt ihnen das Zeugnis aus, dass sie sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt hatten, „um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten“ (1. Thes 1,9.10).
Paulus begegnet in beiden Briefen einem Problem, das bei diesen Gläubigen aufgekommen war. Im ersten Brief geht es um eine Frage hinsichtlich der entschlafenen Gläubigen. Die Thessalonicher waren in Sorge, weil sie dachten, die entschlafenen Gläubigen würden im Blick auf das kommende Reich benachteiligt sein. Paulus macht ihnen klar, dass das durchaus nicht der Fall ist. Er zeigt ihnen, dass lebende und entschlafene Gläubige durch die Entrückung wieder vereint werden, um gemeinsam bei dem Herrn zu sein und dann mit Ihm in Macht und Herrlichkeit auf der Erde zu erscheinen. Im zweiten Brief geht es um eine Frage hinsichtlich der noch lebenden Gläubigen. Falsche Lehrer versuchten die leidenden und bedrängten Thessalonicher zu beunruhigen, indem sie ihnen sagten, dass der Tag des Herrn (d. h. die Gerichte, die dem tausendjährigen Reich vorausgehen) schon gekommen sei. Paulus macht ihnen klar, dass das unmöglich der Fall sein konnte. Er erklärt ihnen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit dieser Tag kommen kann, und dass die Gerichte der Endzeit erst nach der Entrückung der Gläubigen stattfinden. Damit beantworten beide Briefe eine Frage, die viele Gläubige immer bewegt hat und über die es bis heute viel Unklarheit gibt. Es wird deutlich, dass die Entrückung ganz sicher vor der großen Drangsal stattfindet und dass die Gläubigen der Gnadenzeit keineswegs durch die Stunde (Zeit) der Versuchung gehen müssen, die einmal über den ganzen Erdkreis kommen wird (Off 3,10).1
2. Verfasser, Verfassungsort und Echtheit des Briefes
2.1. Der Verfasser
Paulus nennt sich selbst in beiden Briefen als Verfasser (1. Thes 1,1; 2. Thes 1,1), ohne jedoch auf sein Apostelamt hinzuweisen. Dies ist umso bemerkenswerter, weil er in beiden Briefen erstens wichtige Mitteilungen macht und zweitens durchaus mit Autorität auftritt. In Thessalonich gab es jedoch keinerlei Zweifel an seiner apostolischen Autorität, sodass dieser Hinweis entfallen konnte. Absender und Adressaten verband eine herzliche Liebe.
In beiden Briefen verbindet Paulus sich mit seinen Mitarbeitern Timotheus und Silas2. Es ist jedoch völlig klar, dass Paulus als der eigentliche Verfasser gilt, der vom Heiligen Geist getrieben wurde, beide Briefe zu schreiben. In 1. Thessalonicher 2,18 wird das ganz deutlich (vgl. 2. Thes 2,5). In 2. Thessalonicher 3,17 betont er, dass er eigenhändig einen Gruß schreibt und dass dieser Gruß das Zeichen der Echtheit des Briefes ist. In beiden Stellen schreibt Paulus in der Ich-Form.
Die beiden genannten Mitarbeiter lernen wir in der Apostelgeschichte kennen:
- Timotheus: Er ist den meisten Bibellesern gut bekannt und war ein treuer Mitarbeiter von Paulus, der ihn bis an das Ende seines Dienstes begleitet hat. Die beiden Briefe, die Paulus an ihn schreibt, geben davon Zeugnis. In Philipper 2,20–22 stellt Paulus ihm das besondere Zeugnis aus, dass er keinen Gleichgesinnten hatte, der von Herzen für das Wohl der Gläubigen besorgt war, und dass er, wie ein Kind dem Vater, mit Paulus an dem Evangelium gedient hatte. Damit nimmt Timotheus unter den Mitarbeitern von Paulus eine besondere Stellung ein.
- Silas: Er stammte aus der Versammlung in Jerusalem und war ein angesehener Bruder mit einer prophetischen Gabe (Apg 15.22.32), der im Volk Gottes nützlich war. Wie Paulus war er jüdischer Herkunft und besaß zugleich die römische Staatsbürgerschaft. Die Apostelgeschichte erwähnt seinen Namen in den Kapiteln 15–18 mehrfach. Er begleitete Paulus auf der zweiten Missionsreise. Danach verlieren wir ihn für eine Zeit aus den Augen. Auf der dritten Missionsreise scheint er nicht dabei gewesen zu sein. Petrus nennt ihn später noch einmal und bezeichnet ihn als einen „treuen Bruder“ (1. Pet 5,12).
2.2. Verfassungsort und Zeit
Nach seinem Besuch bei den Thessalonichern anlässlich seiner zweiten Missionsreise war Paulus nach Süden weitergereist und über Athen nach Korinth gekommen. In der Zwischenzeit war Timotheus von Athen aus nach Thessalonich zurückgekehrt, um nach ihrem Wohlergehen zu sehen und Paulus Nachricht zu bringen (vgl. 1. Thes 3,2). Als Paulus diese Nachricht bekam, schrieb er von Korinth aus seinen ersten Brief.3 Nur kurze Zeit später folgte dann ein zweiter Brief. Dieser Brief ist eine Antwort auf weitere Fragen der Thessalonicher in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn Jesus und steht deshalb inhaltlich in direkter Verbindung mit dem ersten Brief. Durch wen die Fragen der Thessalonicher Paulus übermittelt wurden, wissen wir nicht. Möglicherweise war es der Überbringer des ersten Briefes, der in der Zwischenzeit zu Paulus zurückgekehrt war.
Wie bereits erwähnt, gelten beide Briefe als frühe apostolische Dokumente, die kurz hintereinander von Korinth aus geschrieben wurden. Die meisten bibeltreuen Ausleger nehmen an, dass beide Briefe zwischen 52 und 54 geschrieben worden sind (einige datieren ihn sogar noch etwas früher). Wie dem auch sei, beide Briefe sind jedenfalls sehr frühe Dokumente und wahrscheinlich die ersten Briefe von Paulus überhaupt.4
2.3. Echtheit (Authentizität)
An der Tatsache, dass Paulus der eigentliche Verfasser beider Briefe ist, kann es keinen berechtigten Zweifel geben. Zum einen gibt er sich selbst in beiden Briefen als Autor zu erkennen, zum anderen gibt es ausreichend externe Bestätigungen bei den sogenannten „Kirchenvätern“, die in ihren Schriften auf diesen Brief verweisen. Ignatius und Polycarp spielen auf einige Aussagen des ersten Briefes an, Irenäus zitiert den ersten Brief und schreibt ausdrücklich, dass er von Paulus geschrieben worden sei. Gleiches gilt für Clemens Alexandrinus. Beim zweiten Brief ist es ähnlich. Ignatius und Justin erwähnen ihn. Irenäus spricht ausdrücklich von dem „zweiten Brief an die Thessalonicher“ und zitiert ihn ebenso wie Clemens Alexandrinus, der ihn einen Brief von Paulus nennt. Gleiches gilt ebenfalls für Tertullian. Der frühe Kanon Muratori (Ende des 2. Jahrh.) enthält ebenfalls beide Briefe als von Paulus verfasst.
Für die frühen Christen war es also keine Frage, dass beide Briefe erstens ein Teil des inspirierten Wortes Gottes sind und dass zweitens Paulus der Verfasser ist.
Es muss uns dennoch nicht wundern, dass bibelkritische Theologen die Echtheit beider Briefe (und besonders des zweiten Briefes) und somit Paulus als Verfasser ablehnen.5 Die alte Frage des Teufels ist immer aktuell: „Hat Gott wirklich gesagt ...?“ (1. Mo 3,1). Die Argumente, die sie vorbringen, sind zum Teil an Haaren herbeigezogen und halten keiner Prüfung statt. Gleiches gilt für die Behauptung, dass einige Teile der Briefe unecht seien und es später redaktionelle Ergänzungen gegeben habe. Der Textbefund spricht jedenfalls eine andere Sprache. Der Brief weist alle Kennzeichen der Inspiration auf und trägt in Inhalt, Sprache und Stil durchaus die Handschrift von Paulus. Einige bibelkritische Gelehrte haben darüber hinaus versucht nachzuweisen, dass es zwei verschiedene Gemeinden in Thessalonich gab (eine heidnische und eine jüdische), die jede einen Brief bekommen habe. Man hat ebenfalls versucht, den zweiten Brief zeitlich vor den ersten Brief zu setzen. All das macht keinen Sinn. Im Gegenteil, beim Lesen der beiden Briefe wird ganz klar, dass der zweite Brief in unmittelbarer Verbindung zum ersten Brief steht und auf diesen aufbaut, indem die Belehrung des ersten Briefes vertieft und erweitert wird. Man kann den zweiten Brief nicht wirklich verstehen, wenn man den ersten nicht gelesen hat.
Es lohnt an dieser Stelle nicht, näher auf die Einwände einzugehen.6 Wir halten daran fest, dass beide Briefe Teil des Wortes Gottes sind und Paulus der vom Heiligen Geist benutzte Verfasser ist. Gemeinsam mit Silvanus und Timotheus hat er diesen Brief an die Gläubigen in Thessalonich geschickt. Für jeden bibeltreuen Christen kann es keinen Zweifel geben, dass Paulus der Gemeinde in Thessalonich zwei Briefe geschrieben hat – Briefe, von denen wir bis heute profitieren.
3. Die Stadt Thessalonich
Thessalonich (heute Thessaloniki, Saloniki) liegt im Norden des heutigen Griechenland am Ägäischen Meer. Damals wurde dieses Gebiet in zwei große Teile eingeteilt. Der nördliche Teil hieß Mazedonien mit den Städten Philippi, Thessalonich und Beröa. Der südliche Teil hieß Achaja mit den Städten Athen und Korinth.
Thessalonich wurde im Jahr 315 v. Chr. von Kassander, einem griechischen General Alexanders des Großen gegründet. Seine Frau war eine Halbschwester Alexanders und hieß Thessalonika. Ihr zu Ehren wurde die Stadt so genannt. Unter den Römern, die Thessalonich 168 v. Chr. eroberten, wurde die Stadt zu einer Provinzhauptstadt und Sitz eines römischen Prokonsuls. Thessalonich konnte sich weitgehend selbst verwalten und besaß Autonomie in allen inneren Angelegenheiten. Im ersten Jahrhundert war Thessalonich eine der bedeutenden Städte der Region. Man nimmt an, dass dort ca. 200.000 Menschen lebten. Die Stadt lag an der Via Egnatia, einer großen Heerstraße, die Rom mit dem Orient verband. Aus diesem Grund war Thessalonich eine große Handelsstadt, in der sich viele Juden niedergelassen hatten. Als Hafenstadt hatte Thessalonich allerdings zugleich einen Ruf für Unmoral und Zügellosigkeit.
4. Paulus in Thessalonich
Viele Aussagen in beiden Briefen selbst können wir besser verstehen und einordnen, wenn wir den geschichtlichen Hintergrund vor Augen haben, der diesem Brief zugrunde liegt. Lukas berichtet darüber ausführlich in Apostelgeschichte 17,1–9. Paulus und sein Mitarbeiter Silas (Silvanus) kamen nach Thessalonich. Wir befinden uns in diesem Kapitel auf der zweiten Missionsreise von Paulus, die ihn zum ersten Mal überhaupt nach Europa brachte (Apg 16,6–12). Von Troas (im Nordwesten Kleinasiens gelegen) kamen die beiden Missionare nach Mazedonien. Die erste Reisestation war Philippi, wo die erste europäische Versammlung (Gemeinde) entstand (Apg 16,13–40). Von dort aus ging die Reise in südwestlicher Richtung in das etwa 150 km entfernte Thessalonich. Hier wohnten offensichtlich etliche Juden, weil es eine „Synagoge der Juden“ gab (Apg 17,1). Dem inspirierten Bericht des Lukas können wir entnehmen, dass Paulus sich an drei Sabbaten mit den Thessalonichern in der Synagoge unterhielt und dass eine Reihe von Menschen durch die Predigt zum Glauben kam.
Etliche der Juden wurden jedoch von Neid erfüllt und versuchten, das beginnende Werk des Herrn im Keim zu ersticken. Ein von ihnen in Szene gesetzter Volksauflauf brachte die ganze Stadt in Aufruhr. Aus diesem Grund musste Paulus Thessalonich bei Nacht verlassen. Paulus schreibt in seinem ersten Brief, dass er und Silas „durch Verfolgung weggetrieben“ wurden (1. Thes 2,15). Die nächste Reisestation war Beröa. Von dort aus ging Paulus nach Athen, während er Silas und Timotheus zurückließ.7 Später folgten diese beiden dem Apostel. Weil Paulus keine Möglichkeit sah, selbst nach Thessalonich zurückzukehren (siehe 1. Thes 2,18), gleichzeitig jedoch in Sorge um die jungen Gläubigen dort war, sandte er Timotheus zu ihnen zurück. Daran erinnert er in seinem ersten Brief. „Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden und wir sandten Timotheus, unseren Bruder ..., um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens...“ (1. Thes 3,1.2). In Korinth trafen sich die drei wieder (Apg 18,5). Von Korinth aus schrieb Paulus dann zunächst den ersten und später den zweiten Brief. Die Zeitspanne zwischen beiden Briefen beträgt vielleicht nur einige Wochen oder Monate. In jedem Fall waren Paulus, Silvanus und Timotheus (die in beiden Briefen zusammen genannt werden) immer noch zusammen.
Von einem weiteren Besuch des Paulus in Thessalonich berichtet das Neue Testament nichts Genaues. In Apostelgeschichte 19,21.22 sehen wir, dass Paulus den Gedanken hatte, erneut nach Mazedonien zu reisen und Timotheus und Erastus vorausschickte. Nach Apostelgeschichte 20,1 war Paulus anschließend selbst in Mazedonien. Er ermunterte die Gläubigen mit vielen Worten. Ob und wie lange Paulus auf dieser dritten Missionsreise allerdings in Thessalonich gewesen ist und wie es ihm dort ergangen ist, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.
5. Die Versammlung in Thessalonich
Es hilft uns ebenfalls, manche Aussagen in den beiden Briefen besser zu verstehen, wenn wir einen kurzen Blick auf die Gläubigen in dieser großen Hafen- und Handelsstadt werfen, die Paulus „die Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (1. Thes 1,1) bzw. „Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (2. Thes 1,1) nennt.
In Apostelgeschichte 17,4 erwähnt Lukas drei verschiedene Gruppen von Menschen, die das Evangelium des Heils gehört und den christlichen Glauben angenommen hatten:
- einige von den Juden
- solche von den anbetenden Griechen (das waren ehemalige Heiden, die den heidnischen Götzendienst aufgegeben hatten und so jüdische Proselyten geworden waren. Sie beteten den Gott der Juden an.
- nicht wenige von den vornehmsten Frauen (wahrscheinlich Griechinnen)
Beim Lesen beider Briefe wird darüber hinaus deutlich, dass die Mehrzahl der Gläubigen in Thessalonich von den Heiden zum Glauben gekommen waren, denn nur von diesen konnte gesagt werden, dass sie sich von den Götzenbildern zu dem lebendigen Gott bekehrt hatten (1. Thes 1,9). Die Gefahren, vor denen Paulus in 1. Thes 4,1–8 warnt, waren ebenfalls ein besonderes Problem für ehemalige Heiden (und weniger für gebürtige Juden).
Wir haben es also – wie häufiger in den Briefen – mit einer örtlichen Gemeinde zu tun, die aus gebürtigen Juden und gebürtigen Heiden bestand, wobei die Heiden wahrscheinlich den größeren Anteil ausmachten. Offensichtlich gab es in dieser jungen Versammlung jedoch keine Verständigungsschwierigkeiten zwischen diesen beiden Gruppen, wie wir sie in anderen Versammlungen (z. B. in Rom) finden.
Paulus stellt diesen jungen Gläubigen ein gutes Zeugnis aus. Sie hatten das Wort mit großer Freude als das Wort Gottes aufgenommen. In ihrem missionarischen Eifer waren sie einzigartig und vorbildlich. Ihr Glaube hatte sich schnell über die Grenzen der eigenen Stadt und des eigenen Landstriches verbreitet. Sie folgten dem Beispiel der Missionare und wurden selbst für andere zum Vorbild. Ihr Leben zeigte, dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott und zu ihrem Herrn hatten.
Doch das war nur die eine Seite. Die Thessalonicher befanden sich zugleich in großer äußerer Bedrängnis und Verfolgung vonseiten ihrer eigenen Landsleute. Die Probleme, die bereits während des Aufenthaltes von Paulus in Thessalonich begonnen hatten, setzten sich fort. Schon im ersten Brief erinnert Paulus sie daran, dass sie das Wort in vieler Drangsal aufgenommen hatten (1. Thes 1,6). Im zweiten Kapitel spricht Paulus wieder davon (Verse 14–16), und im dritten Kapitel sehen wir seine Sorge, die er sich deshalb machte. Er wusste sehr wohl, dass Drangsale und Schwierigkeiten mutlos machen können, zumal der Versucher (der Teufel) solche Umstände gern benutzt, um den Kindern Gottes zu schaden (1. Thes 3,2–7). Als Paulus den zweiten Brief schrieb, hatten die Drangsale nicht nachgelassen. Im Gegenteil, die äußere Situation hatte sich noch verschärft. Die Not war so groß, dass einige der Thessalonicher dachten, sie gingen durch die Gerichte, die mit dem Tag des Herrn in Verbindung stehen. Hinzu kam, dass der Versucher nun tatsächlich Menschen benutzte, um diese jungen und geprüften Gläubigen bewusst in die Irre zu führen und ihren Glauben und ihre Gesinnung zu erschüttern (vgl. 2. Thes 2,1–3). In diese Situation hinein schreibt Paulus nun an seine geliebten Glaubensgeschwister, um sie zu ermutigen, zu belehren und gleichzeitig zu warnen.
6. Die Predigt des Paulus in Thessalonich
Der Inhalt der Botschaft, die Paulus den Thessalonichern verkündigt hatte, ist von zentraler Bedeutung, um die beiden Briefe an diese jungen Gläubigen gut zu verstehen. Wenn wir Apostelgeschichte 17,1–9 aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass die Predigt von Paulus zwei Kernbotschaften enthielt, die wir in beiden Briefen wiederfinden:
- Den ersten Punkt finden wir in den Versen 2 und 3. Paulus ging in die Synagoge und bewies dort aus den Schriften des Alten Testaments, dass der Christus leiden und aus den Toden auferstehen musste „und dass dieser ... Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist“. Paulus bewies den Zuhörern aus dem Alten Testament heraus, dass der Jesus, den sie an das Kreuz genagelt hatten, der von Gott angekündigte Messias (d. h. der Christus oder der Gesalbte) war, der gelitten hatte und nun auferstanden war. Für einen Juden war gerade diese Botschaft schwer zu akzeptieren, er musste sie allerdings annehmen, um errettet zu werden. Beim genauen Lesen fällt auf, dass die Betonung hier nicht so sehr darauf liegt, dass Christus gestorben ist (obwohl das grundsätzlich natürlich fundamental ist), sondern dass Er gelitten hat. Das schließt seine Ablehnung durch sein Volk (die Juden) und die Nationen ein (vgl. Apg 4,27). Paulus sagte mit anderen Worten: „Diesen Jesus, den ihr abgelehnt und gekreuzigt habt, ist der Christus Gottes. Die Auferstehung beweist, dass Gott sein Werk angenommen hat. Sein Leiden ist beendet. Er ist auferstanden.“ Die Gläubigen in Thessalonich wurden also mit einem auferstandenen und doch zugleich abgelehnten Christus verbunden. Diese Verbindung hatte zur Folge, dass sie jetzt in seiner Nachfolge ebenfalls durch Leiden zu gehen haben würden. Paulus war ihnen in diesen Leiden ein Vorbild (Kap. 3,4), und sie selbst hatten schnell kennengelernt, was es heißt, in der Nachfolge des Herrn zu leiden.
- Den zweiten Hauptpunkt der Predigt des Paulus finden wir in Apostelgeschichte 17,6.7. Dort bezeugen die Gegner von Paulus selbst, was er verkündigt hatte, und sie fassen damit ungewollt einen wesentlichen Kernpunkt seiner Belehrung zusammen. Sie sagen: „Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei – Jesus.“ Paulus hatte also den Herrn Jesus nicht nur als Heiland gepredigt, sondern ebenfalls als den König seines Reiches8. Der von den Menschen abgelehnte und getötete Jesus von Nazareth ist kein anderer als der, den Gott zum Herrn und Christus gemacht hat. Obwohl Er als König mehr mit seinem irdischen Volk Israel verbunden ist, so kennen wir Ihn doch heute als den Herrn seines Reiches (besser Königreiches), dem wir dienen. Die Predigt dieses Reiches hat Paulus nie vernachlässigt. Er hat immer wieder davon geredet, dass der Herr Jesus nicht nur Retter, sondern zugleich Herr ist. Zwar hat Er seine Herrschaft noch nicht öffentlich in Macht und Herrlichkeit angetreten, in den Herzen der Gläubigen ist Er allerdings jetzt schon derjenige, dessen Autorität und Rechte wir gerne anerkennen wollen. Allerdings kommt der Zeitpunkt, wo Er dieses Reich auf der Erde sichtbar aufrichten wird. Dann kommt Er in Macht und Herrlichkeit als König auf diese Erde, um seine Herrschaft öffentlich anzutreten. Paulus muss darüber ausführlich mit den Thessalonichern gesprochen haben, denn sie wussten davon, dass Er kommen würde, um die Regierung anzutreten. Davon zeugen beide Briefe. Offensichtlich gehört die Belehrung darüber zu dem Basisunterricht junger Gläubiger.
Die beiden genannten Punkte sind eng miteinander verbunden und beinhalten wichtige Belehrungen für die Gläubigen bis heute. Der damals von den Juden abgelehnte Jesus ist immer noch in dieser Welt geächtet. Man will seinen Herrschaftsanspruch nicht anerkennen. Er hat gelitten, und denen, die Ihm folgen, ergeht es prinzipiell nicht anders. Wir sind Knechte (manche sprechen von Untertanen) in seinem Reich, das für die Menschen dieser Welt unsichtbar ist. Gott hat Ihn zum Herrn und Christus gemacht, und als solcher wird Er wiederkommen, um sein Reich in Macht und Herrlichkeit zu gründen. Auf dieses Kommen freuen wir uns. Bis dahin sollten wir Ihn gerne als den Herrn unseres Lebens anerkennen.
Diese beiden Kerngedanken ziehen sich durch beide Briefe. Die Thessalonicher hatten das Wort aufgenommen in vieler Drangsal (Leiden), und zugleich mit Freude des Heiligen Geistes (1. Thes 1,6). Leiden sind ein äußeres Kennzeichen des Reiches Gottes in seiner heutigen Form (Apg 14,22), Freude im Heiligen Geist ist ein inneres Kennzeichen dieses Reiches (Röm 14,17). Deshalb hatte Paulus ihnen bezeugt, würdig zu wandeln des Gottes, der sie zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hatte (1. Thes 2,12). Im zweiten Brief wird dieser Gedanke erneut aufgenommen. Dort schreibt Paulus, dass die Gläubigen würdig geachtet wurden des Reiches Gottes, um dessentwillen sie auch litten (2. Thes 1,5). In der Tat leiden die Gläubigen jetzt mit dem Herrn. Alle, die gottselig leben wollen, werden verfolgt werden – wenngleich oft nur in sehr schwachem Maß (2. Tim 3,12). Doch es kommt der Tag, an dem Er verherrlicht wird „in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben“ (2. Thes 1,10). Dann sind die Leiden beendet und die Rollen werden vertauscht. Diejenigen, die heute die Gläubigen verfolgen, bekommen dann ihre gerechte Strafe. Diejenigen, die heute verfolgt werden, werden Ruhe finden (2. Thes 1,6–9).
7. Der Anlass
Wenn Paulus einen Brief schrieb, gab es dafür immer einen Grund. In der Regel erkennen wir diesen beim Lesen der betreffenden Briefe selbst. Bei den Thessalonichern war es offensichtlich in beiden Fällen eine Nachricht, die Paulus über sie empfangen hatte. Grundsätzlich waren die Informationen über die Gläubigen in Thessalonich dazu angetan, das Herz des Apostels zu erfreuen. Im ersten Brief schreibt er: „Wir danken Gott allezeit für euch alle ..., gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater... Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern geworden seid“ (1. Thes 1,3–7). Sie hatten sich – soweit es Heiden waren – von den Götzenbildern bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmel zu erwarten (1. Thes 1,9.10). Dieser Glaube an Gott war an jedem Ort verbreitet worden. Das war ein lebendiges Zeugnis einer jungen Versammlung, von der wir viel lernen können. Im zweiten Brief schreibt er: „Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet“ (2. Thes 1,3.4).
Dennoch gab es bei den Thessalonichern natürlich Wissenslücken (sie waren ja noch jung im Glauben), die Paulus schließen wollte. Es war ihm ein Anliegen, das zu vollenden, was an ihrem Glauben mangelte (1. Thes 3,10). Das betraf zum einen Fragen über die Zukunft der entschlafenen (im ersten Brief) bzw. lebenden Gläubigen (im zweiten Brief), es betraf jedoch ebenso Fragen des praktischen christlichen Lebens. Beide Briefe enthalten wichtige Hinweise für den Lebensalltag des Christen. Paulus spricht z. B. über Themen wie praktische Heiligung und Reinheit oder die Notwendigkeit der Arbeit mit den eigenen Händen.
8. Inhalt
Wir erinnern uns daran, dass Paulus in Thessalonich über das Reich Gottes gesprochen hatte. Er hatte über den Herrn Jesus als den „König“ dieses kommenden Reiches gesprochen. Nun lebten die Thessalonicher in der ständigen Erwartung des Wiederkommens des Herrn Jesus (Kap. 1,10). Sie wussten und erlebten, dass Er jetzt auf dieser Erde abgelehnt wurde. Umso größer war ihre Freude im Blick auf das kommende öffentliche Reich in Macht und Herrlichkeit, in dem Christus regieren wird und die Gläubigen mit Ihm. Dieser Augenblick der Machtübernahme stand so lebendig vor ihren Augen, dass sie täglich damit rechneten. Offensichtlich hatte Paulus bei seinem Besuch nicht ausführlich darüber gesprochen, dass dieses Reich nicht unmittelbar gegründet werden konnte, sondern dass es dazu Voraussetzungen gab. Eine dieser Voraussetzung ist das Kommen des Herrn, um die Seinen zu entrücken. Diese Wahrheit prägt den ersten Brief. Eine zweite Voraussetzung ist, dass dieses Reich (der Tag des Herrn) durch Gerichte eingeleitet wird. Diese Wahrheit prägt den zweiten Brief. In beiden Punkten bestand Unklarheit.
8.1. Der erste Brief
Offensichtlich war es so, dass einige der gläubigen Thessalonicher gestorben waren. Die Übrigen waren nun in großer Unruhe, denn sie meinten, die Verstorbenen wären nun nicht dabei, wenn das Reich gegründet würde. Diesem Problem begegnet Paulus in seinem ersten Brief. Es ist davon auszugehen, dass gerade diese Frage der eigentliche Grund für Paulus war, diesen Brief zu schreiben. Jedenfalls prägt er seinen Inhalt. In 1. Thessalonicher 4,13 sagt Paulus: „Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die Übrigen, die keine Hoffnung haben.“ Dann erläutert er ausführlich, dass der Herr Jesus zuerst kommen wird, um die entschlafenen Heiligen aufzuerwecken und gleichzeitig mit ihnen die lebenden Gläubigen zu entrücken. Somit gibt es keine Benachteiligung derjenigen, die entschlafen waren. In Kapitel 5,10 kommt der Apostel noch einmal darauf zurück und schreibt: „... damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.“ Der Zusammenhang und die Belehrung des Briefes machen klar, dass es sich hier sowohl um lebende als auch um heimgegangene Gläubige handelt.
Die Belehrungen über das Kommen des Herrn, die den Zentralpunkt dieses Briefes bilden, sollen jeden Leser ermuntern und erbauen (1. Thes 5,11). Das war damals nötig und das ist bis heute nicht anders. Das Kommen des Herrn wird in jedem Kapitel erwähnt. Jedes Mal verbindet Paulus damit einen besonderen Gedanken:
- 1. Thessalonicher 1,9.10: Hier wird das Kommen des Herrn als Lebenshaltung und Lebensprogramm dargestellt. Das Leben des Gläubigen basiert auf zwei Säulen. Erstens dienen wir Gott, und zweitens haben wir eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung darauf, dass der Sohn Gottes aus den Himmeln zurückkommt, ist ein wesentliches Kennzeichen des christlichen Lebens. Christen sind zielorientierte Menschen. Die Wiederkunft des Herrn ist kein theoretisches Wissen, sondern sie beeinflusst unseren Wandel, unser Tun, unser Reden und unser Denken.
- 1. Thessalonicher 2,19.20: Paulus spricht von der Ankunft unseres Herrn Jesus und verbindet damit den Lohn (Krone) für den Diener. Paulus freute sich auf den „Siegeskranz“. Bei seiner Erscheinung wird offenbar werden, was jeder für Ihn auf dieser Erde gewesen ist.
- 1. Thessalonicher 3,12.13: Die Lebensführung der Gläubigen soll einerseits durch Liebe und andererseits durch Heiligkeit gekennzeichnet sein. Es sollte für uns selbstverständlich sein, praktisch heilig und hingebungsvoll zu leben und uns gleichzeitig von allem Bösen abzuwenden. Wer zielorientiert lebt und täglich auf den Herrn wartet, wird darin bessere Fortschritte machen als ein Christ, der irdisch gesinnt lebt.
- 1. Thessalonicher 4,13–18: Diese Verse sind vielen Bibellesern gut bekannt. Hier erklärt Paulus den Unterschied zwischen der Entrückung der Gläubigen, um bei dem Herrn zu sein, und der Erscheinung des Herrn mit seinen Heiligen. Der Abschnitt beinhaltet jedoch nicht nur eine wichtige Belehrung, sondern ist gleichzeitig Ermunterung und Trost für solche, die einen ihrer Lieben abgegeben haben. Wir werden allezeit bei dem Herrn sein, bei Ihm, der uns so sehr liebt. Paulus endet mit der Aufforderung: „So ermuntert nun einander mit diesen Worten.“
- 1. Thessalonicher 5,1–11: Diese Verse setzen den Gedankengang von Kapitel 4,13.14 fort. Für den Glaubenden ist das Kommen des Herrn Trost und Ermunterung; für jeden, der nicht glaubt, bedeutet es unausweichliches, schreckliches und ewiges Gericht. Es sind ernste Worte, die Paulus schreibt: „... und sie werden nicht entfliehen.“
Obwohl die Lehre vom Kommen des Herrn u. a. in diesem Brief vorgestellt wird, ist er gleichwohl nicht in erster Linie ein „Lehrbrief“ wie z. B. der Römer-, Kolosser- oder Epheserbrief. Es geht im Kern um die Praxis des christlichen Lebens und darum, dass wir zielorientiert leben. Dieses Leben ist untrennbar mit der Hoffnung verbunden, dass der Herr bald wiederkommt. Gerade deshalb ermuntert uns dieser Brief und macht uns Mut, unserem Gott mit Hingabe zu dienen und gleichzeitig unseren Herrn Jesus aus den Himmeln zu erwarten.
8.2. Der zweite Brief
Der Inhalt des zweiten Briefes hängt ebenfalls eng mit der Situation der Thessalonicher zusammen, die sich in der kurzen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Brief verändert hatte.
- Verfolgung und Bedrängnis hatten nicht abgenommen, sondern im Gegenteil zugenommen. Deshalb brauchten diese jungen Gläubigen Ermunterung. Diese Ermunterung gibt Paulus ihnen, indem er sie an das kommende Reich Gottes erinnert (Kap. 1,5). Bereits im ersten Brief hatte er von dem Reich Gottes geschrieben und sie zu einem Wandel aufgefordert, der würdig des Gottes sein sollte, der sie zu diesem Reich berufen hatte (Kap. 2,12). Jetzt erklärt er ihnen, dass der Weg in dieses Reich durch Leiden gehen würde. Die Verfolgungen, in denen sie standen, waren durchaus nicht ungewöhnlich oder überraschend, sondern sie waren mit diesem Reich verbunden (vgl. Apg 14,22). Gleichzeitig macht Paulus ihnen klar – und das muss eine Motivation für die Briefempfänger gewesen sein –, dass der Tag kommt, an dem die Rollen sozusagen vertauscht werden (Kap. 1,6–8). Wenn das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit aufgerichtet ist, dann bedeutet das Ruhe für diejenigen, die jetzt verfolgt werden, und Gericht für die, die jetzt die Gläubigen unterdrücken. Das ist der Inhalt von Kapitel 1. Es ist durch Ermunterung geprägt.
- Kapitel 2 bildet den Hauptteil des Briefes, der einen belehrenden Charakter hat, denn die Thessalonicher standen in der Gefahr, durch falsche Lehrer verführt zu werden. Wer genau diese Verführer waren, wissen wir nicht. Es liegt jedoch nahe zu vermuten, dass es jüdische Lehrer waren, die Werkzeuge des Teufels waren, um die himmlische Hoffnung dieser Gläubigen zu verdunkeln. Diese Orientierung auf das Ziel hin, die einen Christen kennzeichnen soll, war es gerade, was die Thessalonicher ausgezeichnet hatte (vgl. 1. Thes 1,10). Genau an dieser Stelle setzte der Verführer nun an, indem er das Christentum und seine Hoffnung auf den Boden des Judentums und seiner Erwartungen ziehen wollte.
Worin die Verführung bestand, wird uns in Kapitel 2,1–3 gesagt: „Wir bitten euch aber, Brüder, ... dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen.“ Von diesem Tag des Herrn hatte Paulus bereits im ersten Brief gesprochen (Kap. 5,2). Es ist die Zeitspanne, wo das Reich Gottes in Herrlichkeit und Macht auf dieser Erde sichtbar wird. Diese Phase beginnt mit furchtbaren Gerichten, die diese Welt treffen und der Erscheinung des Herrn vorausgehen werden. Sie schließt das tausendjährige Friedensreich und dessen Ende mit ein.
Die Verführer wollten den Thessalonichern nun klarmachen, dass die Drangsale und Verfolgungen, die sie zu erdulden hatten, mit diesem Tag des Herrn in Verbindung standen und folglich als ein Gericht vonseiten Gottes verstanden werden sollten. So wurden sie im Glauben erschüttert, obwohl Paulus ihnen im ersten Brief schon klar gesagt hatte, dass der Herr Jesus uns von dem kommenden Zorn erretten wird (1. Thes 1,10) und dass wir nicht zum Zorn gesetzt sind (1. Thes 5,9). Die Gerichte, die dieser Tag mit sich bringt, sind nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, ganz besonders für die Juden. Christen warten nicht auf die Drangsal, sondern auf die Entrückung, die vor den Drangsalen stattfinden wird.
Die Kernfrage der Thessalonicher war, ob sie sich schon am Tag des Herrn befanden oder nicht. Satan benutzte ihre Umstände, um diesen Irrtum in ihr Herz zu legen. Dabei schreckten die falschen Lehrer vor keinem Mittel zurück. Sie gingen so weit, dass sie sich sogar auf einen Brief bezogen, der angeblich von dem Apostel Paulus geschrieben worden sein sollte. Deshalb betont Paulus am Ende sehr deutlich, dass er der Verfasser dieses zweiten Briefes ist (Kap. 3,17). Einen dritten (inspirierten) Brief an die Thessalonicher hat er nicht geschrieben. - c) Aus dem Irrtum bezüglich des Tages des Herrn resultierte ein Fehlverhalten einiger in der Versammlung in Thessalonich. Die falschen Lehrer nahmen den Thessalonichern die Hoffnung weg. Wenn der Tag des Herrn schon da war, dann war es nicht mehr notwendig, auf sein Kommen zur Entrückung zu warten. Ein Vergleich von 1. Thessalonicher 1,3 mit 2. Thessalonicher 1,3 zeigt uns, dass die Gläubigen in Thessalonich nicht mehr so von der Hoffnung durchdrungen waren wie am Anfang. Im ersten Brief wird der christliche Dreiklang aus Glaube, Liebe und Hoffnung lobend hervorgehoben. Im zweiten Brief wird die Hoffnung in der Einleitung nicht mehr genannt. Sie musste neu aktiviert werden. Es mag sein, dass einige in Thessalonich deshalb anfingen, unordentlich zu wandeln und ihre reguläre Arbeit vernachlässigten (Kap. 3,6–11). Aus diesem Grund hatten sie Ermahnung und Korrektur nötig. Auch das gibt ihnen der Apostel Paulus im dritten Kapitel.
Für uns liegt darin der wichtige Grundsatz, dass falsche Belehrung immer zu einem falschen Verhalten führt. Unser praktischer Wandel ist äußerst wichtig. Er benötigt jedoch ein Fundamt und findet dieses nur in einer richtigen Belehrung. Wenn die Belehrung falsch ist, wird das im Leben sichtbar werden. Allerdings ist es ebenfalls möglich, dass wir richtig belehrt sind und uns trotzdem falsch verhalten. Dies macht ein Fehlverhalten umso ernster.
9. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Briefen
Schon beim flüchtigen Lesen beider Briefe wird deutlich, dass es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. In beiden Briefen geht es darum, die Briefempfänger zu ermuntern und zu motivieren. In beiden Briefen hebt Paulus das hervor, was Gott durch seinen Geist in diesen jungen Gläubigen hervorbringen konnte. In beiden Briefen nimmt Paulus das als Grundlage, um zu vollenden, was noch an ihrem Glauben mangelte.
Beide Briefe finden ihren eigentlichen Anlass darin, dass die Thessalonicher Fragen hatten, die mit dem Kommen des Herrn verbunden waren. In beiden Briefen nimmt die Ankunft des Herrn Jesus eine zentrale Stellung ein. Der Ausgangspunkt ist jedoch – wie wir gesehen haben – sehr verschieden. Im ersten Brief geht es um ein Problem der Toten, d. h. genauer gesagt der entschlafenen Heiligen. Im zweiten Brief hingegen handelt es sich um ein Problem der Lebenden. Die Frage lautet, ob die Drangsale, durch welche die Gläubigen zu gehen haben, mit den Gerichten des Tages des Herrn zu tun haben.
Zum Verständnis beider Briefe – ganz besonders des zweiten Briefes – ist es unabdingbar, zwischen dem Kommen des Herrn für die Seinen und dem Kommen des Herrn mit den Seinen zu unterscheiden, ohne beides voneinander zu trennen. Es ist wohl ein Kommen (seine Ankunft, gr. parousia), es hat jedoch zwei Seiten, die wir nicht verwechseln dürfen. Zum einen geht es um die Entrückung (wenn der Herr kommt, um die Seinen zu holen, gr. harpazo). Zum anderen geht es um seine Erscheinung (wenn der Herr kommt, um sein Reich aufzurichten, gr. epiphaneia). Wer diese beiden Seiten nicht unterscheidet, wird mit beiden Briefen große Schwierigkeiten haben und zu falschen Schlussfolgerungen kommen.
Der Herr Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, zurückzukommen, um sie zu sich zu nehmen (Joh 14,3). Er hatte also selbst schon, als Er noch auf der Erde war, die Entrückung angedeutet. Ganz am Ende der Bibel sagt Er uns zu: „Ich komme bald“ (Off 22,20). Das zählt. Wir warten nicht auf irgendwelche Ereignisse, die noch stattfinden müssen, sondern wir warten auf den Herrn, auf den Kommenden (Heb 10,37). Das macht der erste Brief deutlich.
Wenn es allerdings um sein Erscheinen in Herrlichkeit mit den Seinen auf dieser Erde geht, so zeigt uns der zweite Brief sehr wohl, dass es Ereignisse gibt, die zwingend stattfinden müssen, bevor der Herr in Gericht auf dieser Erde erscheint. Im Lauf des Briefes werden einige dieser Ereignisse genannt, ganz besonders im Hauptteil von Kapitel 2,1–12. Der Tag des Herrn kann noch gar nicht da sein, weil die beschriebenen Ereignisse (z. B. das Erscheinen des Menschen der Sünde) noch gar nicht eingetreten sind.
Bei allen inhaltlichen Unterschieden ist die Art und Weise, in der Paulus vorgeht, in beiden Briefen sehr ähnlich. W. Kelly schreibt in seiner Auslegung über den zweiten Brief: „Wie in seinem ersten Brief bekämpft der Apostel den Irrtum nicht direkt, sondern bereitet die Herzen der Heiligen schrittweise und von allen Seiten darauf vor, so dass die Wahrheit festgehalten und der Irrtum ausgeschlossen wird, sobald er in Erscheinung tritt. Das ist die Vorgehensweise der göttlichen Gnade und Weisheit; das Herz wird zurechtgebracht, und es wird nicht nur der einzelne Irrtum und die einzelne Sünde behandelt.“9 Von dieser Vorgehensweise der göttlichen Gnade dürfen wir heute noch profitieren und lernen.
10. Gliederung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beide Briefe einzuteilen.10 Es bietet sich an, den ersten Brief unter folgenden Überschriften zu lesen:
- Der praktische Zustand der Thessalonicher (Kap. 1)
- Der Dienst des Apostels Paulus (Kap. 2)
- Timotheus Sendung und sein Bericht (Kap. 3)
- Der heilige Wandel der Gläubigen (Kap. 4,1–12)
- Das Kommen des Herrn (Kap. 4,13–18)
- Der Tag des Herrn (Kap. 5,1–11)
- Praktische Hinweise an die Gläubigen (Kap. 5,12–28)
Im zweiten Brief bietet sich eine Dreiteilung an. Das erste Kapitel ist eine Einleitung, in der Paulus die Gläubigen ermuntert, in ihren Drangsalen durchzuhalten. Kapitel 2 bildet den eigentlichen Hauptteil der Belehrung, indem Paulus ihr Wissen über das Kommen des Herrn auf diese Erde vertieft und erweitert. Ab Kapitel 2,13 bis zum Ende geht es um praktische Dinge, die ganz besonders mit dem Fehlverhalten einiger in Thessalonich zu tun haben. Deshalb können wir diesen Brief unter folgenden Überschriften lesen:
- Zur Ermunterung: Leiden im Reich Gottes (Kap. 1)
- Zur Belehrung: Der Tag des Herrn und der Mensch der Sünde (Kap. 2,1–12)
- Zur Hilfe: Vorrechte und Verantwortlichkeiten (Kap. 2,13–3,18)
Es lohnt sich, diese beiden ersten Briefe des Apostel Paulus intensiver zu studieren. Wir werden daraus reichlich Nutzen ziehen.11
Anhang: Die Ankunft des Herrn Jesus und der Tag des Herrn
Wir haben gesehen, dass es zum richtigen Verständnis der beiden Briefe an die Thessalonicher wichtig ist, zwischen der Entrückung der Gläubigen und der Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit zu unterscheiden. In diesem Zusammenhang begegnen uns zwei Begriffe, die wir richtig verstehen müssen.
a) Die Ankunft des Herrn Jesus
Wenn wir beide Briefe zusammennehmen, begegnet uns das Wort „Ankunft“ siebenmal. Es ist sozusagen charakteristisch für das, was Paulus den Thessalonichern erklärt (1. Thes 2,19; 3,13; 4,15; 5,23; 2. Thes 2,1.8.9). Im Grundtext steht hier das Wort „parousia“, das sich aus den zwei Wortteilen „para“ (mit) und „ousia“ (sein) ableitet. Das macht deutlich, dass es nicht nur um den konkreten Zeitpunkt eines Kommens oder Erscheinens geht, sondern zugleich um eine damit verbundene Gegenwart. Jemand kommt und bleibt. In Philipper 2,12 benutzt Paulus gerade dieses Wort, wenn er von seiner „Gegenwart“ bei den Philippern spricht. Im Neuen Testament wird „parousia“ achtzehnmal für die Wiederkunft des Herrn Jesus gebraucht. W. E. Vine schreibt dazu: „Wenn es für die Wiederkunft Christi benutzt wird, so bedeutet es nicht nur sein momentanes Kommen für die Seinen, sondern seine Gegenwart mit ihnen von diesem Augenblick an bis zu seiner Offenbarung und Erscheinung vor dieser Welt.“12 Es geht also nicht nur um einen Zeitpunkt, sondern um eine Zeitspanne, die einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende hat.
Wenn es um die Ankunft des Herrn Jesus geht, so hat die Zeitspanne zwei Phasen:
- Der Herr kommt, um die Seinen zu „entrücken“ (1. Thes 4,17), damit wir dann für immer bei Ihm sind. Das Wort „Entrückung“ beschreibt etwas, das weggenommen, weggerissen oder geraubt wird. So nimmt der Herr die Seinen bei seiner Ankunft zur Entrückung von dieser Erde weg. Auf diese Ankunft warten wir. Sie macht die typisch christliche Hoffnung aus.
- Die Ankunft setzt sich fort, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit auf der Erde erscheint und sein Reich gründet. Während die eigentliche Entrückung von dieser Welt nicht wahrgenommen wird, ist die „Erscheinung seiner Ankunft“ (2. Thes 2,8) ein öffentliches Ereignis. „Erscheinung“ bedeutet „Aufleuchten“. Dieses Wort wird für das Erscheinen des Herrn Jesus in Niedrigkeit auf dieser Erde gebraucht (2. Tim 1,10). In Matthäus 24,27 benutzt der Herr selbst dieses Wort, wenn Er sein Kommen in Macht und Herrlichkeit mit einem Blitz vergleicht, der ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet.
Die Ankunft des Herrn wird im Neuen Testament eigentlich als ein Kommen gesehen, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.13 In Titus 2,13 verbindet Paulus beide Seiten in einer einzigen Aussage. Er schreibt davon, dass wir „die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus“ erwarten. Die glückselige Hoffnung ist die Entrückung. Die Erscheinung ist sein Kommen in Macht und Herrlichkeit.
Untersucht man die verschiedenen Stellen, wo von der „Ankunft (parousia)“ gesprochen wird, stellt man fest, dass es eine Reihe von Stellen gibt, in denen der Anfang dieser Zeitperiode im Vordergrund steht. Es gibt andere Stellen, die hauptsächlich von dem Verlauf sprechen, und wieder andere Stellen, die mehr auf das Ende dieser Zeitperiode abzielen. Beispiele für die erste Rubrik sind 1. Thessalonicher 4,15 und 5,23; 2. Thessalonicher 2,1; 1. Korinther 15,23; 2. Petrus 3,4. Beispiele für die zweite Rubrik sind 1. Thessalonicher 2,19 und 3,13; Matthäus 24,3.37.39; 1. Johannes 2,28. Beispiele für die dritte Rubrik sind 2. Thessalonicher 2,8; Matthäus 24,27.
b) Der Tag des Herrn
Der „Tag des Herrn“ ist ein Begriff, der über dreißigmal in den prophetischen Schriften des Alten Testaments vorkommt. Es ist klar, dass es dabei nicht um einen Tag von 24 Stunden geht, sondern um einen bestimmten Zeitabschnitt, der von bestimmten Merkmalen gekennzeichnet ist.14 Des Weiteren ist klar, dass wir diesen „Tag des Herrn“ nicht mit „des Herrn Tag“, dem Sonntag verwechseln dürfen (Off 1,10). Der „Tag des Herrn“ ist in den prophetischen Schriften ein Synonym für die eine Zeitperiode, die dadurch gekennzeichnet sein wird, dass die Autorität und Herrschaft des Herrn Jesus auf der Erde öffentlich anerkannt wird. Schon das Alte Testament zeigt, dass es diese Zeitspanne geben wird, in der unser Herr als König kommt, um sein Reich auf der Erde zu gründen und dann in Frieden und Gerechtigkeit zu regieren. Diese Zeitperiode beginnt mit Gericht, sie geht über in die tausendjährige Friedensherrschaft des Herrn auf dieser Erde und sie endet wiederum mit Gericht, bevor dann der „Tag Gottes“ (2. Pet 3,12.13), der „Tag der Ewigkeit“, beginnt. Heute leben wir in einer Zeit, die wir als „Tag des Menschen“ bezeichnen könnten. Die Autorität des Herrn Jesus wird mit Füßen getreten. Satan regiert unter den Ungläubigen dieser Welt. Am Tag des Herrn hingegen wird alles wieder in Übereinstimmung mit Ihm gebracht werden. Gott wird alles unter die Füße des verherrlichten Menschen Jesus Christus stellen (Ps 8,7; Eph 1,10).
Im Alten Testament erwähnen die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Obadja, Amos, Zephanja, Sacharja und Maleachi den „Tag des Herrn“. Im Neuen Testament lesen wir davon in Apostelgeschichte 2,20; 1. Thessalonicher 5,2; 2. Thessalonicher 2,2 und 2. Petrus 3,10. Auch 1. Korinther 5,5 und 2. Korinther 1,14 können genannt werden. Ein sorgfältiges Studium der einzelnen Stellen zeigt, dass die Mehrzahl der Verse von dem Beginn dieses Tages, also von den Gerichten, spricht. Andere Stellen zeigen uns das eigentliche Reich, und wieder andere Stellen sprechen von dem Ende dieses Tages. In den beiden Briefen an die Thessalonicher geht es eindeutig um den Beginn dieser Periode, die durch furchtbare Gerichte gekennzeichnet sein wird und durch die kein Gläubiger der Gnadenzeit gehen wird.
Fußnoten
- 1 Man spricht in diesem Zusammenhang oft von dem sogenannten „Prätribulationismus“ (englisch Pre-Tribulationsism) und dem sogenannten „Posttribulationismus (englisch „Post-Tribulationism“). Prätribulationismus bedeutet zu Deutsch „Vor-Entrückung“. Gemeint ist, dass die Entrückung vor der Zeit der großen Drangsal stattfinden wird. Posttribulationismus bedeutet zu Deutsch „Nach-Entrückung“. Gemeint ist, dass die Entrückung nach der Zeit der großen Drangsal stattfinden wird. Die Bibel ist zu diesem Thema eindeutig und zeigt klar, dass die Gläubigen der Gnadenzeit nicht durch die große Drangsal gehen müssen. Die beiden Briefe an die Thessalonicher liefern zur Klärung dieser wichtigen Fragen wesentliche Argumente (vgl. zu diesem Thema ausführlich M. Seibel: „Erleben die Christen die Drangsalszeit?“, Verlag CSV Hückeswagen, und G. Setzer: „Entrückung vor der Drangsalszeit“ in www.Bibelstudium.de).
- 2 Silas wird vermutlich sein semitischer Name gewesen sein (abgleitet von Saul), während Silvanus wahrscheinlich die lateinische Form seines Namens ist.
- 3 Wenn man nur 1. Thessalonicher 3 liest, könnte man meinen, Paulus habe aus Athen geschrieben. Einige Bibelausgaben geben daher auch Athen als Verfassungsort an. In Verbindung mit Apostelgeschichte 18 dürfte jedoch deutlich werden, dass Paulus von Korinth aus schrieb. Korinth war die Hauptstadt von Achaja (siehe Apg 18,12), und Achaja wird in 1. Thessalonicher 1 zweimal erwähnt. Dort war Paulus gemeinsam mit Silas und Timotheus.
- 4 Einige Ausleger gehen davon aus, dass der Galaterbrief noch etwas eher geschrieben worden ist. Beweisen lässt sich das nicht. Fakt ist jedenfalls, dass diese drei Briefe (die beiden an die Thessalonicher und der an die Galater) die ältesten Briefe sind.
- 5 Kritiker nehmen besonderen Anstoß an der Wahrheit über die Entrückung der Gläubigen (1. Thes 4) und an den prophetischen Aussagen über das Auftreten des Antichrists, der als „Mensch der Sünde“ bezeichnet wird (2. Thes 2). Ein weiterer Kritikpunkt sind die Aussagen über das ewige Gericht der Ungläubigen (2. Thes 2).
- 6 Wer das gerne tun möchte, sei auf das Buch „Die Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments“ von E. Mauerhofer verwiesen.
- 7 Aus Apostelgeschichte 17 können wir nicht direkt entnehmen, dass Timotheus bei dem ersten Besuch in Thessalonich dabei gewesen war. Gleiches gilt für den vorherigen Aufenthalt und die Haft in Philippi. In beiden Fällen ist lediglich die Rede von Paulus und Silas. Allerdings lesen wir Kapitel 16,3, dass Paulus ihn mit auf die Reise nehmen wollte. Erst in Kapitel 17,14 wird er wieder erwähnt. Dort befindet Paulus sich bereits in Beröa. Es ist denkbar, dass Timotheus dort zu den beiden gestoßen ist oder dass Lukas ihn als jüngeren Reisebegleiter vorher einfach nicht erwähnt.
- 8 Es ist bemerkenswert, wie oft Paulus in seiner Predigt das Reich Gottes thematisiert. In Apostelgeschichte 20 ist es neben dem Evangelium Gottes und dem Ratschluss Gottes (über Christus und die Versammlung) eines der drei großen Themen seines Dienstes (Apg 20,18-27).
- 9 W. Kelly: The Second Epistle to the Thessalonians
- 10 Es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass solche Einteilungen nur Hilfestellungen sein können. Im Grundtext gibt es weder eine Einteilung in Kapitel noch Verse. Sie sind später von Menschen zugefügt worden, um das Lesen und das Verständnis zu erleichtern. Ähnlich verhält es sich mit inhaltlichen Einteilungen, die wir vornehmen. Sie sollen eine Hilfe sein – nicht mehr und nicht weniger. Deshalb gibt es in aller Regel auch verschiedene Möglichkeiten, ein Bibelbuch einzuteilen.
- 11 Vgl. dazu z. B. vom gleichen Verfasser die beiden ausführlichen Auslegungen über die beiden Briefe an die Thessalonicher: „Den Herrn erwarten“ und „Der Tag des Herrn“ (beide im Beröa Verlag in Zürich erschienen).
- 12 W. E. Vine: Expository Dictionary of the New Testament
- 13 So gesehen ist es nicht ganz richtig, von dem ersten und zweiten Kommen des Herrn zu reden, wenn man seine Wiederkunft für uns und mit uns unterscheiden will. Es ist tatsächlich ein Kommen – jedoch in zwei Phasen.
- 14 Vgl. die Ausdrücke „Tag des Heils“ (2. Kor 6,2) oder „Tag des Zorns“ (Röm 2,5).

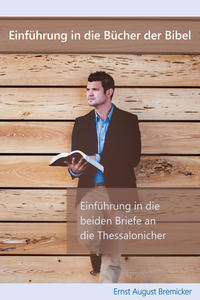
 Download als PDF (DIN A4)
Download als PDF (DIN A4) Download als EPUB
Download als EPUB Download als MOBI
Download als MOBI Modul für theWord (Kommentar)
Modul für theWord (Kommentar)