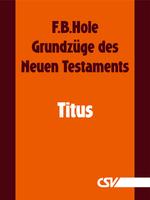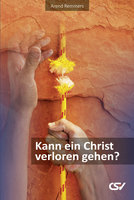Einführung in den Brief an Titus

Der Brief an Titus betont besonders das praktische Verhalten der Gläubigen im täglichen Leben, ein Verhalten, das der gesunden Lehre entsprechen soll. Es geht um die „Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist“ (Tit 1,1). Paulus schreibt über die Lehre, aber eben so, wie sie sich im täglichen Leben zeigt. Es geht sehr konkret um das christliche Verhalten und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Älteren und Jüngeren, der Frauen und Männer sowie der Knechte. Darüber hinaus wird über die richtige Einstellung gegenüber dem Staat und den ungläubigen Mitmenschen gesprochen. Der Christ soll durch Gottseligkeit und gute Werke gekennzeichnet sein. Die vielen praktischen Hinweise sind eingebettet in eindrucksvolle und belehrende Ausführungen über den Heilsplan Gottes, der von Ewigkeit her besteht, in der Gegenwart realisiert wird und ewige Folge hat. Dieser Heilsplan Gottes (die Wahrheit über den Heiland-Gott) ist Grundlage für das praktische Leben des Christen.1
Man könnte den Brief mit den Worten beschreiben: „Verwirrung braucht Ordnung“. Es ist ein relativ kurzer Brief von Paulus, dessen Inhalt wir jedoch nicht übersehen sollten. Martin Luther schreibt in seiner Vorrede zu diesem Brief: „Dies ist eine kurze Epistel, aber ein Ausbund christlicher Lehre, darin allerlei so meisterlich verfasst ist, das einem Christen not ist zu wissen und zu leben.“2
Der Dienst von Paulus hat das Ziel, die von Gott auserwählten Gläubigen zu einer besseren Erkenntnis der Wahrheit zu führen (Tit 1,1-3). Diese Erkenntnis der Wahrheit zeigt sich in der Gottseligkeit, d.h. in einer Lebensführung, die Gott verherrlicht. Damit verbunden ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Genau dieser Auftrag und dessen Folgen werden im Titusbrief in den Mittelpunkt gerückt.
1. Der Verfasser des Briefes
Der Autor ist Paulus. Er verbindet sich in diesem Brief nicht mit anderen Dienern des Herrn. Da er seinen Mitarbeiter Titus konkret anweist, schreibt er allein, inspiriert durch den Heiligen Geist. Paulus stellt sich selbst vor als „Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi“ (Tit 1,1), d.h. er macht deutlich, dass er diesen Brief als Diener (Sklave Gottes), jedoch zugleich mit apostolischer Autorität schreibt. Mit dem Begriff „Knecht“ zeigt Paulus, dass er Gott gegenüber zum Dienst und zum Gehorsam verpflichtet war. Mit dem Begriff Apostel stellt er die ihm von Christus verliehene Autorität als Botschafter in den Vordergrund. Auf diese Autorität weist er ebenfalls in den beiden Timotheusbriefen hin. Obwohl es ein persönlicher Brief an einen Mitarbeiter ist, wird er zugleich mit apostolischer Autorität geschrieben. Die apostolische Autorität prägt den gesamten Brief.
Bibelkritische Ausleger haben die Verfasserschaft von Paulus abgelehnt3. Sie finden dafür eine Reihe von Argumenten, die allerdings einer genaueren Prüfung nicht standhalten. Es ist müßig, auf diese Argumentationen einzugehen, weil sie zu nichts führen.4 Wer von der göttlichen Inspiration – und damit der Unfehlbarkeit – der Bibel ausgeht, wird nicht den geringsten Zweifel daran haben, dass dieser Brief von Paulus geschrieben worden ist. Im Übrigen wird der Brief an Titus von einigen der sogenannten Kirchenvätern erwähnt und zitiert, so z.B. bei Ignatius, Justin, Theophilus von Antiochien und Irenäus. Irenäus bezeichnet ihn ausdrücklich als einen von Paulus geschriebenen Brief. Gleiches gilt für Clemens Alexandrinus und Tertullian. Im Kanon von Muratori ist der Titusbrief ebenfalls als paulinischer Brief enthalten.
2. Der Empfänger des Briefes
Paulus schrieb an seinen Mitarbeiter Titus. Der Name bedeutet „der Wertgeschätzte“. Das war Titus in der Tat – sowohl für Paulus als auch für andere.
Aus den verschiedenen Hinweisen im Neuen Testament erhalten wir folgendes Bild über Titus:
- Titus war kein Jude, sondern hat griechische Wurzeln. Beide Elternteile waren Griechen. Er war als Junge nie beschnitten worden.
- Aus Galater 2,1-3 können wir entnehmen, dass Titus aus Antiochien in Syrien stammte. Einige Ausleger vermuten, dass er ein Bruder des Arztes Lukas war5. Ob es tatsächlich so ist, muss offen bleiben.
- Titus war für Paulus zum einen ein Bruder im Herrn. Paulus nennt ihn ausdrücklich „meinen Bruder“ (2. Kor 2,13).6 Zum anderen war er ein Mitarbeiter und Genosse (d. h. Teilhaber, Gefährte, Mitbetroffener) von Paulus, den er an verschiedenen Orten einsetzen konnte (2. Kor 8,23). Er war nützlich zum Dienst und für Paulus eine Hilfe. Paulus nennt seine Gegenwart einen Trost für ihn selbst (2. Kor 7,6).
- In Titus 1,4 redet Paulus ihn als sein „echtes Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben“ an. Das ist erstens ein Hinweis darauf, dass Titus durch den Dienst von Paulus zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen war. Es ist zweitens ein Hinweis darauf, dass Titus deutlich jünger war als Paulus (vgl. Tit 2,6-8). Er hätte vermutlich – wie Timotheus – sein leibliches Kind sein können). Es ist drittens ein Hinweis auf das gute Verhältnis eines älteren Dieners zu einem jüngeren Diener (vgl. Phil 2,22).
Titus wird in der Apostelgeschichte nicht erwähnt, obwohl er dort – wie aus Galater 2,1-4 hervorgeht – bereits gemeinsam mit Paulus reiste7. Dieser Tatbestand hat einige Ausleger zur der Auffassung gebracht, Titus und Timotheus seien ein und dieselbe Person. Es ist jedoch offensichtlich, dass dies ein Irrtum ist. Timotheus war ein Halbjude (er hatte einen griechischen Vater, aber eine jüdische Mutter), während Titus ein nicht beschnittener Grieche mit griechischen Eltern war.
In der Auseinandersetzung über die Bedeutung des Gesetzes für die Gläubigen aus den Heiden (Nationen) spielt Titus eine wichtige Rolle. Falsche Brüder waren unterwegs, die versuchten, den Gläubigen aus den Nationen das Gesetz aufzuerlegen und sie zu zwingen, sich beschneiden zu lassen. Die falschen Lehrer kamen u.a. nach Antiochien – die Heimat von Titus – und versuchten dort für Unruhe zu sorgen. Daraufhin wurde festgelegt, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem reisen sollten, um diese Streitfrage zu klären (Apg 15.1.2). Sie nahmen Titus mit (Gal 2,1). Seine Anwesenheit wurde zu einem Präzedenzfall, denn er wurde am Ende, „obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen“ (Gal 2,3).8
Neben den angeführten Referenzstellen im Galaterbrief wird Titus achtmal im 2. Korintherbrief genannt (2. Kor 2,13; 7,6.13.14; 8,6.16.23; 12,18). Paulus hatte ihn zweimal nach Korinth geschickt. Er sollte dort Geld für die notleidenden Geschwister in Judäa sammeln. Doch nicht nur das. Wenn wir die verschiedenen Stellen miteinander vergleichen, bekommen wir ein gutes Bild dieses Arbeiters für den Herrn, der ein Herz für seine Glaubensgeschwister und deren geistliches Wohlergehen hatte. Titus kümmerte sich von Herzen um die Schwierigkeiten in Korinth. Paulus sagt, dass Gott ihm denselben Eifer für die Glaubenden ins Herz gegeben hatte (2. Kor 8,16). Titus scheint wie Timotheus ein Mann für besonders schwierige Aufgaben gewesen zu sein. Von seiner Veranlagung her scheint er eher sachorientiert agiert zu haben, während Timotheus mehr beziehungsorientiert war. Im Gegensatz zu Timotheus scheint er darüber hinaus nicht schüchtern und zurückhaltend, sondern eher dynamisch und energisch gewesen zu sein. Er muss eine relativ starke Persönlichkeit gewesen sein. Die Korinther waren dafür bekannt, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben. Doch vor Titus schienen sogar sie Respekt gehabt zu haben, denn sie nahmen ihn „mit Furcht und Zittern“ auf (2. Kor 7,15).
Die verschiedenen Referenzstellen im 2. Korintherbrief zeigen uns Folgendes:
- Titus war ein Diener, der sich freuen konnte, weil er von den Korinthern „erquickt“ worden war. Er sah nicht nur das Negative, sondern freute sich über Positives (2. Kor 7,13).
- Titus war – trotz aller Rationalität – ein Mann, der Emotionen zeigen konnte. Paulus erwähnt ausdrücklich seine „innerlichen Gefühle“ (2. Kor 7,15). Titus war offen für Anregungen und Hinweise von anderen. Er akzeptierte, das Paulus ihm „zuredete“ (ermahnte) (2. Kor 8,6.16; 12,17). Obwohl Titus offen für Input von anderen war, war er zugleich eigeninitiativ und eifrig. Paulus erwähnt ausdrücklich, dass er „von sich aus“ zu den Korinthern gegangen war (2. Kor 8,16).
- Titus war nicht nur ein Einzelkämpfer, sondern er war in der Lage mit anderen zusammenzuarbeiten. Paulus nennt ihn deshalb seinen „Genossen“ und einen „Mitarbeiter“ (2. Kor 8,23)
- Titus war jemand, der fair und objektiv handelte und nicht nach Gunst oder Ansehen der Person. Paulus stellt ihm das Zeugnis aus, dass er die Korinther nicht übervorteilt hatte (2. Kor 12,18).
In 2. Timotheus 4,10 lesen wir zum letzten Mal etwas von Titus. Er blieb bis zum Lebensende von Paulus treu für die Sache seines Herrn. Paulus war allein in seiner zweiten Haft in Rom und hatte den Tod vor Augen. Bis auf Lukas, der bei ihm war, hatten ihn alle verlassen. Der eine – Demas – weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hatte, andere – darunter Titus – weil sie Aufgaben für den Herrn zu tun hatten.
Das Bild, das wir in den angeführten Stellen von Titus bekommen, ist deshalb wichtig, weil der Brief an ihn relativ wenig von dieser persönlichen Zuneigung und Wertschätzung des Paulus wiederspiegelt. Die einzigen persönlichen Aussagen finden wir in Titus 1,4.5; 2,15. Er nennt ihn sein echtes Kind und spricht davon, dass ihn niemand verachten soll. Die persönliche Zuneigung – wie wir sie etwa in den Briefen an Timotheus finden (z. B. 1. Tim 1,18; 6,11.20; 2. Tim 1,3-6; 2,1; 3,14.15) – fehlt im Titusbrief. Der Titusbrief enthält wichtige Anordnungen und Belehrungen über die Wahrheit Gottes und das Verhalten der Gläubigen und die Umstände waren offensichtlich nicht so, dass Paulus es für gut hielt, viel über seine eigenen Empfindungen Titus gegenüber zu schreiben. Deshalb ist es gut, dass uns die übrigen Referenzstellen darüber mehr sagen.
3. Der zeitgeschichtliche Hintergrund
Es ist klar, dass der Brief von Paulus geschrieben wurde und an Titus adressiert war. Es ist ebenfalls klar, dass Titus sich in Kreta befand, als er den Brief bekam (Tit 1,5). Sehr wahrscheinlich haben Zenas und Apollos ihn überbracht (Tit 3,13). Aus Titus 3,12 kann man ferner entnehmen, dass Paulus den Brief schrieb, während er sich auf dem Weg nach Nikopolis9 befand, dort jedoch noch nicht angekommen war. Da Nikopolis in Griechenland liegt, muss sich Paulus also in Griechenland aufgehalten haben, als er den Brief schrieb.
Schwieriger hingegen ist es, den Zeitpunkt zu benennen, wann der Brief geschrieben wurde. Für die Auslegung ist das nicht wichtig, dennoch ist es ein Punkt, über den wir in einer Einleitung zu einem Brief nachdenken werden. Der Zeitpunkt steht und fällt der Beantwortung der Frage, wann Paulus und Titus in Kreta gearbeitet haben und wann Paulus Titus dort zurückgelassen hat (Tit 1,5). Da wir in der Apostelgeschichte keinerlei Hinweis auf einen gemeinsamen und längeren Besuch von Paulus und Titus auf dieser Insel finden, gehen die meisten konservativen Ausleger davon aus, dass dieser Besuch nach der ersten, zweijährigen Gefangenschaft in Rom (Apg 28,30) stattgefunden hat. Die Briefe, die Paulus während seiner Haft in Rom schrieb (an die Epheser, Philipper, Kolosser und an Philemon), lassen diesen Rückschluss zu, denn sie zeigen, dass Paulus davon ausging, bald wieder in Freiheit zu sein, um seinen Dienst fortsetzen zu können. Hinweise aus dem 2. Timotheusbrief zeigen, dass er diesen Plan tatsächlich umgesetzt hat und nach seiner Freilassung in die Gebiete zurückkehrte, die er vorher besucht hatte. In dieser Zeit – also während der „vierten Missionsreise“ – sind sehr wahrscheinlich sowohl der erste Brief an Timotheus (Timotheus befand sich zu diesem Zeitpunkt in Ephesus) als auch der Brief an Titus nach Kreta geschrieben worden. Die folgenden Orte hatte Paulus vor zu besuchen: Philippi (Phil 1,26; 2,24; 1. Tim 1,3), Ephesus (1. Tim 1,3; 4,13; vgl. 2. Tim 1,18), Kolossä (Phlm 22), Kreta (Tit 1,5), Nikopolis (Tit 3,12). Es ist davon auszugehen, dass er tatsächlich dort gewesen ist. Folgende Orte hat er ganz sicher besucht: Troas (2. Tim 4,13), Milet und Korinth (2. Tim 4,20).
Somit liegt es auf der Hand, dass Paulus seinen Brief an Titus während dieser letzten Reise geschrieben hat. Die Datierung muss folglich auf einen Zeitpunkt zwischen 62 und 64 n. Chr. angesetzt werden.
Einige Ausleger sind jedoch der Meinung, der Brief sei deutlich früher geschrieben worden und zwar ungefähr im Jahr 56 n. Chr. von Ephesus aus (etwa zeitgleich mit dem 1. Korintherbrief). Sie datieren den Brief also in die Zeit, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird, selbst wenn es dort keinen direkten historischen Bezugspunkt auf einen Besuch von Titus in Kreta gibt. Man muss allerdings bedenken, dass die Apostelgeschichte keinen vollständigen historischen Bericht von den Reisen des Paulus und seiner Begleiter gibt, so dass dieser Tatbestand nicht unbedingt als Beweis gegen diese Aussage zu werten ist. Deshalb kann man nicht ganz ausschließen, dass die im Titusbrief genannten Umstände (sein Aufenthalt in Kreta und die Reise von Paulus nach Nikopolis) durchaus in eine frühere Zeit passen können.
Allerdings kann man ausschließen, dass der Besuch von Paulus und Titus in Kreta etwas mit Apostelgeschichte 27,7.8 zu tun hat. Dort war Paulus als Gefangener auf dem Weg nach Rom zwar für kurze Zeit in Kreta, nur hatte er erstens zu diesem Zeitpunkt keine Gelegenheit, Versammlungen zu besuchen und zweitens gibt es keinen Hinweis darauf, dass Titus bei ihm gewesen wäre.
Der Hinweis auf die Reise nach Nikopolis würde ebenfalls nicht in dieses Bild passen. Der einzige Zeitraum, der in der Apostelgeschichte für einen längeren Besuch in Kreta in Frage kommt, ist in Apostelgeschichte 18,21.22. Dort befindet Paulus sich am Ende seiner zweiten Missionsreise und reist mit dem Schiff von Ephesus nach Cäsarea. Es ist denkbar, dass Titus ihn begleitete und dass Paulus während dieser Reise kurz in Kreta gewesen ist, wo er Titus zurückließ, um ihm dann kurze Zeit später von Ephesus aus seinen Brief zu schreiben.
Es erscheint mir allerdings wahrscheinlicher zu sein, der traditionellen Auffassung zu folgen, dass der Brief zwischen der ersten und zweiten Haft von Paulus in Rom entstanden ist. Er liegt dann zeitlich zwischen dem 1. und dem 2. Brief an Timotheus.
Letztlich ist es – wie bereits bemerkt – von untergeordneter Bedeutung, wann Paulus und Titus in Kreta waren und wann genau der Brief geschrieben wurde. Wichtiger ist, dass es diesen Brief gibt und was er uns zu sagen hat.
4. Paulus und Titus in Kreta
Unabhängig vom Verfassungsdatum geht der Brief davon aus, dass Paulus während einer seiner Reisen – sei es nun die zweite oder die letzte – zusammen mit Titus die Insel Kreta besucht hat. Ob die Versammlungen dort allerdings durch den Dienst von Paulus entstanden sind oder bereits existierten, wissen wir nicht sicher. Denkbar ist durchaus, dass sie entweder durch den Dienst von Juden, die in Kreta lebten, entstanden waren (vgl. Apg 2,11) oder dass andere Brüder missionarisch in Kreta gearbeitet haben. Diese Frage ist ebenfalls von untergeordneter Bedeutung. Paulus war jedenfalls gemeinsam mit Titus in Kreta und hat die Gläubigen besucht. Offensichtlich hatte er gute Gründe, weiterzureisen. Weil er aber eine gewisse Unordnung und Fehlverhalten sah, ließ er Titus dort zurück. Dieser Tatbestand zeigt einmal mehr, wie sehr die „Sorge um alle Versammlungen“ (2. Kor 11,28) Paulus umtrieb und wie er die Notwendigkeit sah, die Gläubigen weiter zu unterweisen.
Kreta ist eine der größeren Mittelmeerinseln. Sie ist relativ gebirgig, etwa 240 km lang und zwischen 10 und 56 km breit. Die Inselbewohner hatten damals keinen besonders guten Ruf. Sie galten als lügnerisch, verschlagen und neigten dazu, ihr Wort zu brechen. Geldgier und mangelnde Bildungsbereitschaft sind weitere Attribute, die ihnen nachgesagt werden.10 Paulus zitiert einen ihrer eigenen Propheten, der gesagt hatte: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche“ (Tit 1,12). Es war also kein einfaches Arbeitsfeld, auf dem Paulus seinen Mitarbeiter Titus zurückgelassen hatten. Offensichtlich hatte Paulus Vertrauen in die Fähigkeiten, die Gott Titus gegeben hatte und die er unter der Leitung des Heiligen Geistes für seinen Dienst gebrauchen konnte.
5. Der Charakter des Briefes
Es fällt beim Lesen der Briefe des Neuen Testamentes auf, dass die beiden Briefe an Timotheus und an Titus einen anderen Charakter tragen als die übrigen Briefe von Paulus. Während die übrigen Briefe – vom Brief an Philemon einmal abgesehen – an örtliche Versammlungen (Gemeinden) gerichtet sind, handelt es ich bei diesen drei Briefen um persönliche Briefe11. Diese persönliche Note prägt den Charakter. Paulus schreibt an seine Mitarbeiter, um ihnen für ihren Dienst wichtige Hinweise und Anweisungen zu geben. Außerdem nimmt er an ihrem Ergehen teil.
Seit dem 18. Jahrhundert bezeichnet man diese drei Briefe häufig als Pastoral- oder Hirtenbriefe. Diese Bezeichnung ist allerdings aus zwei Gründen etwas irreführend. Erstens beschränkt sich ihr Inhalt durchaus nicht auf Anordnungen für den Hirtendienst und die Seelsorge. Zweitens waren weder Timotheus noch Titus – im heutigen Sinn verstanden – dauerhaft angestellte Pastoren (Hirten) in Ephesus und auf Kreta. Sie waren Diener ihres Herrn und Mitarbeiter von Paulus, denen das Wohl der Gläubigen allerdings sehr am Herzen lag und die sich um das Volk Gottes kümmerten.
Es ist für das Verständnis des Titusbriefes wichtig, dass wir berücksichtigen, dass er an eine Einzelperson – an einen Diener – gerichtet ist und nicht an eine örtliche Versammlung. Es ist nicht einmal davon auszugehen, dass der Brief öffentlich vorgelesen werden sollte. Dass der Brief – ebenso wie die beiden Briefe an Timotheus – Teil der Bibel sind und damit eine Botschaft für jeden Leser haben, ist etwas anderes. Genau das war Gottes Absicht, als Paulus die Briefe schreibt. Dennoch halten wir fest, dass die Anordnungen, die Paulus mit apostolischer Autorität gibt, zunächst nicht direkt an Versammlungen gerichtet waren, sondern an seine Mitarbeiter. Titus und Timotheus waren direkt von Paulus beauftragt und autorisiert worden. Das gab ihrem Dienst einen besonderen Charakter. Deshalb darf nicht jede Anweisung unmittelbar auf uns übertragen werden, wie z. B. die Aufforderung, Älteste anzustellen (z. B. Tit 1,5).12
Selbstverständlich schließt der persönliche Charakter des Titusbriefs es nicht aus, dass er für uns eine große Bedeutung hat. Sonst würde er nicht ein Teil des Kanons der Bücher des Neuen Testamentes sein. Beim Lesen des Briefes wird jeder angesprochen. Der Titusbrief hat gerade für unsere Zeit einen hohen Wert, weil der Verfall in der Christenheit stark zunimmt und die „gesunde Lehre“ vielfältig infrage gestellt wird. Wir bekommen wichtige Impulse und Lektionen über den geistlichen Zustand der Gläubigen in der Anfangsphase, der Offenbarung des Bösen, der Bedrohung durch böse Einflüsse von außen und wie wir uns davor schützen können.
6. Die Botschaft des Briefes
In allen drei Pastoralbriefen ist ein wichtiges Kernthema, wie die gesunde Lehre und die Ordnung im Haus Gottes bewahrt bleiben können. Lehre und Praxis gehören untrennbar zusammen. Gleich im ersten Vers spricht Paulus von der „Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist“.
Der besondere Auftrag von Timotheus bestand darin, die Lehre aufrechtzuerhalten (1. Tim 1.3.4). Das wird speziell betont und ist Ausgangspunkt. Danach kommen dann konkrete Hinweise für das praktische Verhalten und die Ordnung im Haus Gottes. Paulus sah die Gefahr böser Lehre und warnt davor. Im Titusbrief liegt der Nachdruck mehr auf der praktischen Ordnung im Haus Gottes. Paulus hatte Titus mit dem Auftrag in Kreta zurückgelassen, das Mangelhafte in Ordnung zu bringen (Tit 1,5). Das war sein konkreter Auftrag. Danach spricht er über die Ermahnung mit der gesunden Lehre. Die Bedrohung durch falsche Lehre steht in diesem Brief nicht im Vordergrund, sondern vielmehr die Bedrohung durch ein falsches Verhalten – und das besonders vor dem Hintergrund des generell schlechten Benehmens der Kreter. Vor dem Hintergrund der etwas geringeren Bedrohung durch falsche Lehre ist der Ton im Titusbrief etwas ruhiger und weniger emotional als in den Briefen an Timotheus.
Der Brief an Titus ist also durchaus keine Wiederholung des 1. Timotheus Briefes, wie manchmal suggeriert wird. Jeder dieser beiden Briefe hat seinen eigenen Schwerpunkt. Der Titusbrief ergänzt und unterstützt das, was Paulus an Timotheus geschrieben hatte. Es geht darum, dass aus der gesunden Belehrung eine gesunde Praxis herauskommt. Die Praxis des christlichen Lebens kann von der gesunden Belehrung nie getrennt werden. Wer in der Lehre ungesund ist, wird in der Praxis ungesund sein. Die Folge ist Unordnung. Umgekehrt ist es unbedingt erforderlich, dass aus der gesunden Lehre eine gesunde Praxis hervorgeht. Ansonsten wird die gesunde Lehre zu einer toten Orthodoxie. Ohne einen Obstbaum (Lehre) kann es keine Früchte (Praxis) geben. Wenn ein Obstbaum allerdings keine Früchte bringt, ist er wertlos. Wenn wir versuchen, einen christlichen Lebenswandel zu führen, ohne ihn auf die biblische Lehre abzustützen, würden wir sehr schnell aus dem geistlichen Gleichgewicht geraten. Wer seine Stellung vor Gott und in dieser Welt nicht kennt und nicht in aller Weisheit und geistlicher Einsicht mit dem Willen Gottes erfüllt ist, kann unmöglich zur Ehre des Herrn leben. Paulus setzt beide Seiten, Wahrheit und Lebenspraxis, ins richtige Verhältnis zueinander. Er schildert uns die Hauptwahrheiten des Christentums als Grundlage unseres Verhaltens im Alltag.
Der Brief ist überwiegend ein praktischer Brief mit vielen Hinweisen, die nicht schwierig zu verstehen sind. In jedem der drei Kapitel gibt es jedoch einen Abschnitt, in dem die „gesunde Lehre“ vorgestellt wird. Der Inhalt dieser Lehre ist Christus selbst. Und in jedem Abschnitt, ist die „gesunde Lehre“ unmittelbar mit der Praxis verbunden.
- Im ersten Abschnitt (Tit 1,1-4) ist Christus derjenige, dem Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen hat, der selbst das ewige Leben ist. Dieser Teil zeigt uns den Vorsatz Gottes im Blick auf uns. Wir sind in der Ewigkeit vor der Zeit zum ewigen Leben auserwählt. Dieses Leben besitzen wir heute schon. Wir werden es allerdings erst dann uneingeschränkt genießen, wenn wir unser Ziel – das Vaterhaus – erreicht haben. Diese wichtige Wahrheit verbindet Paulus im weiteren Verlauf des Kapitels mit der Aufgabe und den praktischen Hinweisen an die Ältesten.
- Der zweite Abschnitt (Tit 2,11-14) stellt uns eine doppelte Erscheinung Christi vor: Er ist erstens erschienen, um den Menschen das Heil Gottes zu bringen. Er wird zweitens erscheinen, um die Gläubigen an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Paulus erwähnt die Gnade Gottes, die in der Vergangenheit in der Person des Herrn Jesus erschienen ist. Diese Gnade unterweist jetzt in der gegenwärtigen Zeit die Gläubigen und richtet ihren Blick zugleich in die Zukunft. Teil dieses Unterrichtes sind die konkreten Hinweise im ersten Teil von Kapitel 2, in dem verschiedene Personengruppen angesprochen werden und in denen es um das nach außen sichtbare Leben der Gläubigen geht.
- Im dritten Abschnitt (Tit 3,3-7) wird die Wahrheit auf unser Inneres angewandt. Paulus spricht über wichtige Themen wie die Wiedergeburt, die Erneuerung durch den Heiligen Geist und die Rechtfertigung. Er spricht von der Güte und Menschenliebe unseres Heiland-Gottes, die in der Vergangenheit durch den Herrn Jesus auf der Erde offenbart wurde. Durch das Werk Gottes in der gegenwärtigen Zeit werden Menschen errettet und durch die Gnade gerechtfertigt. Der Ausdruck „nach der Hoffnung des ewigen Lebens“ richtet uns erneut auf die Zukunft aus. Mit dieser Belehrung verbindet der Apostel den praktischen Hinweis, in der Welt durch unser Verhalten und unsere Werke ein Zeugnis für unseren Herrn zu sein.
Zusammenfassend können wir sagen, dass die Botschaft des Titusbriefes zwei große Ziele hat:
- Das Verhalten des Gläubigen soll so ausgerichtet sein, dass wir ein Zeugnis für den Heiland-Gott sind, dass Menschen zu Ihm kommen. In Titus 2,10 schreibt Paulus „ ... damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem“. Selbst wenn sich dieser Vers konkret auf die Knechte (Sklaven) bezieht, bringt er ein Hauptanliegen von Paulus auf den Punkt: das Verhalten der Gläubigen soll eine Visitenkarte für die Wahrheit sein. Es soll eine Empfehlung für die Menschen sein, den Heiland-Gott kennenzulernen13.
- Das Verhalten des Gläubigen soll so ausgerichtet sein, dass es zur Ehre und Herrlichkeit unseres Herrn ist. In Titus 2,14 spricht Paulus von unserem Heiland Christus Jesus, „... der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken“. Der Herr Jesus möchte hier auf der Erde ein Volk haben, dass zu seiner Ehre lebt und Ihm Freude macht.
7. Schlüsselworte des Briefes
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf einige Ausdrücke, die typisch für den Brief an Titus sind – und die wir ebenfalls in den Briefen an Timotheus finden. Sie bestätigen den besonderen Charakter dieses Briefes:
- Das Wort Heiland (Retter oder Erhalter) kommt im Brief an Titus sechsmal vor und damit öfter als in jedem anderen Buch des Neuen Testaments. Es wird dreimal für Gott (Kap. 1,3; 2,10; 3,4) und dreimal für Christus (Kap. 1,4; 2,13; 3,6) benutzt. Gerade die Tatsache, dass Gott ein „Heiland-Gott“ ist, wird in diesem Brief unterstrichen. Er will alle retten, wenn sie sich nur retten lassen würden.
- Die „Wahrheit“ wird in Titus 1,1.14 erwähnt. Dann wird mehrfach von der „gesunden Lehre“ oder einfach der „Lehre“ (Tit 1,9; 2,1.7.10) gesprochen. Die Lehre ist die Wahrheit oder das „zuverlässige/gesunde Wort“ (Tit 1,2.9; 2,5.8; 3,8).
- Wenn die Wahrheit und die Lehre praktiziert wird, zeigt sich das in einem Verhalten der „Gottseligkeit“ (Tit 1,1; 2,12) und in „guten Werken“ (Tit 1,16; 2,7.14; 3,1.8.14).
8. Gliederung des Briefes
Der Brief an Titus kann in unterschiedlicher Weise eingeteilt werden. Es bietet sich an, der Einteilung in die drei Kapitel zu folgen und jeweils den ersten Vers als Überschrift zu verstehen:
Kapitel 1: Die Wahrheit nach der Gottseligkeit
Kapitel 2: Was der gesunden Lehre geziemt
Kapitel 3: Zu jedem guten Werk bereit
Die ersten beiden Kapitel lassen sich jeweils noch einmal in zwei Teile untergliedern und das dritte Kapitel in drei Teile, sodass wir insgesamt sieben Teile erhalten. In jedem dieser sieben Teile (ausgenommen dem ersten, aufgrund dessen objektiven Charakters) kommt einmal der Ausdruck „gut(e) Werk(e)“ vor. Der erste Vers jedes Kapitels zeigt ein Stück weit den Charakter des Kapitels an.
- Die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist (Kapitel 1)
1.1. Grußwort und Einleitung (Kapitel 1,1–4)
(a) Der Glaube der Auserwählten (Kapitel 1,1–3)
(b) Persönlicher Gruß an Titus (Kapitel 1,4)
1.2. Die Anstellung von Ältesten und ihre Aufgabe (Kapitel 1,5–16)
(a) Älteste und ihre moralischen Eigenschaften (Kapitel 1,5–9)
(b) Warnungen vor falschen Lehrern (Kapitel 1,10–16) - Was der gesunden Lehre geziemt (Kapitel 2)
2.1. Die gesunde Lehre praktizieren (Kapitel 2,1–10)
(a) Durch Ältere und Jüngere (Kapitel 2,1–8)
(b) Durch Knechte (Kapitel 2,9–10)
2.2. Der Inhalt der gesunden Lehre (Kapitel 2,11–15)
(a) Aus der Vergangenheit in die Gegenwart (Kapitel 2,11–12)
(b) Für die Zukunft (Kapitel 2,13)
(c) Ein Rückblick (Kapitel 2,14)
(d) Eine persönliche Aufforderung an Titus (Kapitel 2,15) - Die Bereitschaft zu jedem guten Werk (Kapitel 3)
3.1. Als Christ in der Welt leben (Kapitel 3,1–7)
(a) Unser Verhalten den Menschen geben (Kapitel 3,1–2)
(b) Unser früheres Leben als Sünder (Kapitel 3,3)
(c) Die große Rettungsaktion Gottes (Kapitel 3,4–7)
3.2. Letzte Ermahnungen (Kapitel 3,8–11)
(a) Nützlich und nutzlos (Kapitel 3,8–9)
(b) Der Umgang mit einem sektiererischen Menschen (Kapitel 3,10–11)
3.3. Fürsorge für die Brüder und Grüße (Kapitel 3,12–15)
(a) Nachrichten über Weggenossen des Paulus (Kapitel 3,12–13)
(b) Eine letzte Aufforderung (Kapitel 3,14)
(c) Abschiedsgrüße und Schlusswort (Kapitel 3,15)
Fußnoten
- 1 Hinweis: Eine Auslegung zu dem kompletten Brief ist unter dem Titel „Gesund im Glauben“ vom gleichen Verfasser beim Beröa Verlag Zürich erhältlich.
- 2 Vorrede zu Lutherbibel, Ausgabe 1546
- 3 Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war das anders. Er seit dieser Zeit wird bestritten, dass Paulus der Verfasser ist (das gilt ebenso für die beiden Briefe an Timotheus). Heute bezeichnen liberale Theologen diesen Brief gern als Fälschung oder behauptet zumindest, dass er nur zum Teil von Paulus geschrieben wurde. Dabei gibt es genügend interne und externe Belege, dass niemand anders als Paulus der Verfasser ist. Die Kirchenväter Irenäus, Tertullian, Clemens von Alexandria, Polycarp und Clemens von Rom zitieren aus den Pastoralbriefen und schreiben sie Paulus zu.
- 4 Vgl. dazu ausführlich E. Mauerhofer: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments
- 5 Sie folgern das u.a. aus der Tatsache, dass Titus in der Apostelgeschichte (von Lukas geschrieben) im Gegensatz zu Timotheus nicht erwähnt wird, obwohl er einer der Reisebegleiter von Paulus war.
- 6 Diese sehr schöne Bezeichnung „mein Bruder“ finden wir sonst nur noch bei Epaphroditus (Phil 2.25). Es ist eine besondere Auszeichnung, von Paulus so genannt zu werden.
- 7 Der Codex Sinaiticus spricht in Apostelgeschichte 18,7 von einem Titus Justus, der Codex Vaticanus nennt ihn Titius Justus, während der Codex Alexandrinus nur von einem Justus spricht. Es ist jedoch offenkundig, dass es sich um eine andere Person handelt.
- 8 Es ist auffallend, dass im Fall von Timotheus anders gehandelt wurde. Die Freiheit des Geistes erlaubte es, dass Titus nicht beschnitten wurde, während die gleiche Freiheit des Geistes im Fall von Timotheus eine andere Handlungsweise zuließ. Für Timotheus – der ein Halbjude war – wäre es anderenfalls unmöglich gewesen, Zugang zu den Juden zu finden, während er Paulus auf seinen Missionsreisen begleitete (Apg 16,1-3).
- 9 Nikopolis (Siegesstadt) war eine römische Stadt im Nordwesten Griechenlands, die bis ins 12. Jahrhundert existiert hat. Vor etwa 100 Jahren hat man mit umfangreichen Ausgrabungen begonnen, die einige Rückschlüsse auf das Leben in der Stadt zulassen. Man zählt Nikopolis zu den Orten, in dem bereits sehr früh Christen lebten. Es ist also naheliegend, dass Paulus dort mit anderen Gläubigen zusammen sein wollte, während er überwinterte und auf Titus wartete.
- 10 Vgl. Hatto H. Schmitt, Ernst Vogt: kleines Lexikon des Hellenismus
- 11 Der Brief an Philemon ist ebenfalls ein persönlicher Brief, allerdings trägt er einen deutlich privateren Charakter. Darin unterscheidet er sich von den Briefen an Timotheus und Titus. Interessant ist, dass gerade dieser Brief mit einem privaten Charakter zugleich der Versammlung im Haus von Philemon galt und den Geschwistern zu Kenntnis genommen werden sollte (Phlm 1,2).
- 12 Die Autorität dazu besaßen ausschließlich die Apostel und deren direkte Mitarbeiter, die dazu von den Aposteln persönlich beauftragt waren. Wir können aus diesen Aufforderungen keinesfalls das Recht ableiten, Älteste zu bestimmen oder zu wählen. Die Bibel gibt uns dieses Recht nicht und es ist ein Missbrauch der Briefe an Timotheus und Titus, wenn man doch so handelt.
- 13 Das Wort „zieren“ ist von dem Wort Kosmos abgeleitet, das so viel bedeutet wie: „in Ordnung bringen; verzieren, attraktiv machen“. Man kann das Verhalten der Gläubigen mit einem Rahmen vergleichen, der das wunderbare Bild der Lehre ziert. Das Leben der Gläubigen verändert die objektive Wahrheit nicht, es soll jedoch die Wahrheit für andere attraktiv machen. Und weil das nicht im Verborgenen geschieht, betont der Titusbrief einerseits, dass wir an der gesunden Lehre festhalten (Tit 1,3.9; 2,1.5.7.10) und andererseits, dass wir gute Werke tun sollen (1,16; 2,7.14; 3,1.8.14).


 Download als PDF (DIN A4)
Download als PDF (DIN A4) Download als EPUB
Download als EPUB Download als MOBI
Download als MOBI Modul für theWord (Kommentar)
Modul für theWord (Kommentar)